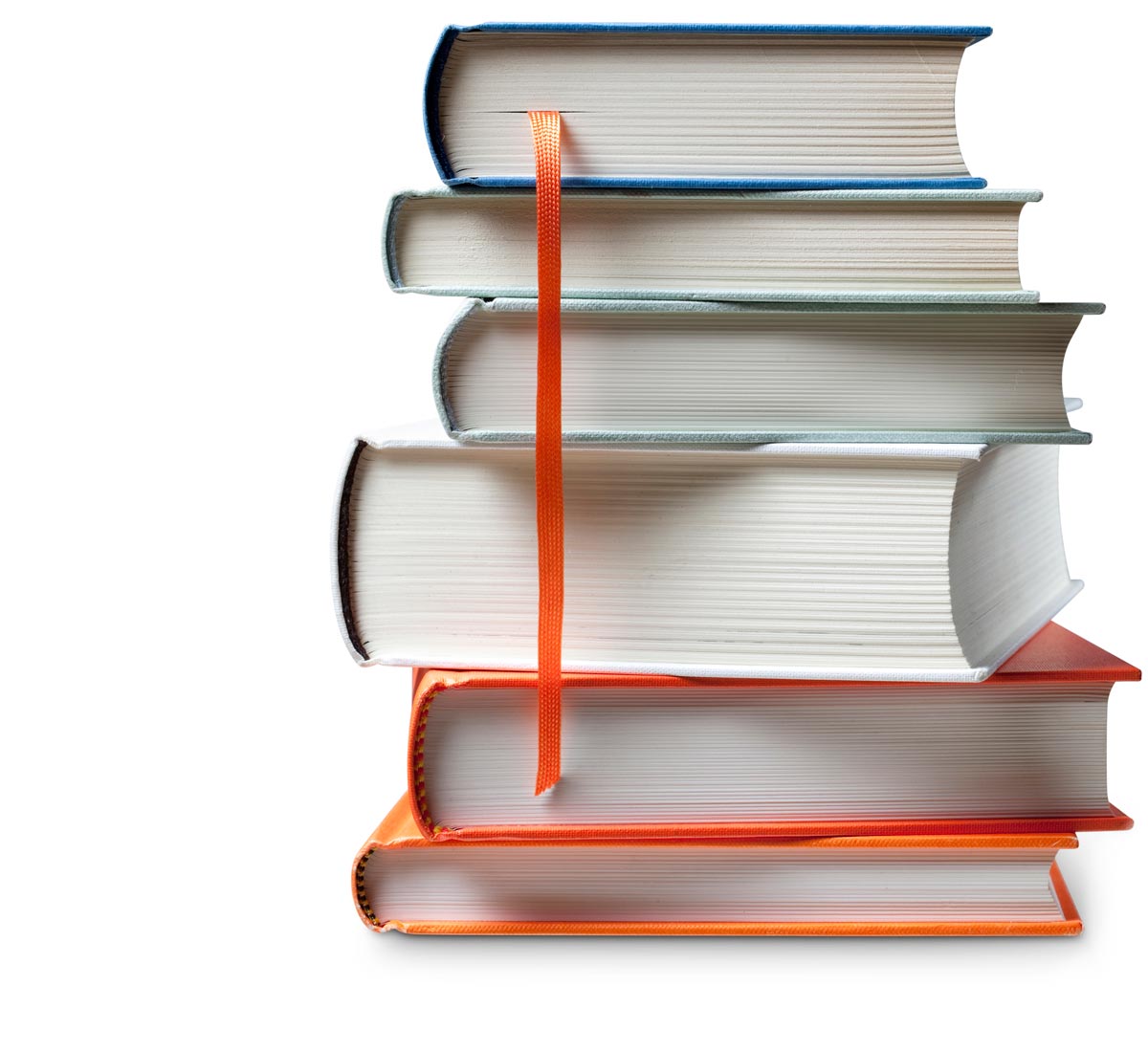Industrie 4.0: Digitalisierung in der Industrie.
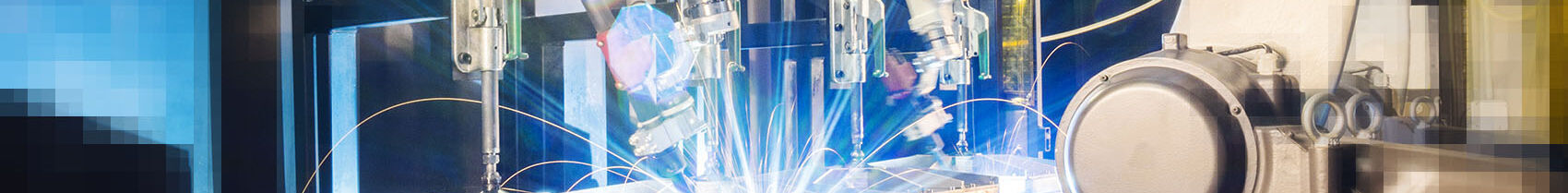
Das produzierende Gewerbe entspricht in etwa dem Industriesektor, der vor allem durch maschinelle Produktion, Arbeitsteilung und Fertigung größerer Stückzahlen gekennzeichnet ist. Bedingt durch den traditionell hohen Technologisierungsgrad und den weit verbreiteten Maschineneinsatz ist die Digitalisierung im produzierenden Gewerbe – oft unter dem Begriff der vierten industriellen Revolution oder Industrie 4.0 zusammengefasst – bereits weit verbreitet und gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Der Trend im produzierenden Gewerbe geht zu immer stärker individualisierten Produkten, die ganz auf die jeweiligen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden können. Auch Kleinserien sollen kostengünstig und effizient hergestellt werden können. Dazu muss die Produktion flexibler werden. Durch die Integration von Computerchips in Geräte sowie (teil)autonome Maschinen, die in der Lage sind, ohne menschliche Steuerung zu handeln (die so genannte Smart Factory) und den ständigen Austausch der intelligenten Technologien können auch kurzfristige Änderungen vorgenommen werden.
Ebenso findet eine immer stärkere Verschmelzung von Produkten und Dienstleistungen, wie beispielsweise Wartungsdienstleistungen für Maschinen, statt. Weitere Neuerungen im produzierende Gewerbe sind auch technologische Entwicklungen wie 3D-Drucker, die immer häufiger zum Einsatz kommen.
Mithilfe der Digitalisierung sind Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe nicht nur in der Lage, eine Echtzeitsteuerung der Produktion zu erreichen, sondern auch Energie- und Ressourcen effizienter einzusetzen und die eigene Produktivität zu steigern.

Informationen und Beratung zu Digitalisierungsthemen für Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe.
Die IHK Bodensee-Oberschwaben berät Unternehmen unter anderem bei der Verwendung digitaler Hilfsmittel zur Informationsgewinnung- und -auswertung (z.B. Robots, Data Mining) sowie der Nutzung digitaler Plattformen im Bereich Open Innovation oder Crowdfunding.
Mit dem kostenlosen IHK-Demografierechner (DemoR) können Unternehmen ihre betriebliche Altersstruktur und deren Veränderung bis zum Jahr 2030 untersuchen. Innerhalb weniger Minuten kann mit dem Online-Rechner die demografische Situation des Unternehmens ermittelt und innerhalb einer beliebigen Branche und Region verglichen werden. Mit den Ergebnissen aus der Webanwendung wird ersichtlich, ob und zu welchem Zeitpunkt Ersatzbedarf für Mitarbeiter bestehen wird. Die Daten aus dem DemoR ermöglichen somit eine verbesserte Personalstrategie, da rechtzeitig nach geeigneten Alternativen gesucht oder etwa stärker in die Ausbildung sowie attraktive Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter investiert werden kann. Damit lässt sich einem möglichen Fachkräftemangel entgegenwirken. Alle Ergebnisse des Demografierechners lassen sich als PDF-Dokument abspeichern, die eingegebenen Daten werden anschließend automatisch aus dem System gelöscht.
Der IHK-Fachkräftemonitor (FKM) ist ein kostenloses Online-Tool, mit dem Unternehmen die Entwicklung von Angebot und Nachfrage auf dem Fachkräftearbeitsmarkt in Baden-Württemberg anhand von Schaubildern, Diagrammen und Karten analysieren können. Berücksichtigt werden dabei Faktoren wie der Bildungsgrad, die Branche sowie die Region. Zudem kann die Entwicklung für die Vergangenheit, die Gegenwart oder als Prognose bis zum Jahr 2030 erstellt werden. Auch der Vergleich mehrerer Berufsgruppen ist möglich. Zudem zeigt der Fachkräftemonitor jeweils die Top 10 der Berufsgruppen und der Branchen nach Region an, in denen der größte Engpass besteht. Abgedeckt werden insgesamt 105 Berufsgruppen in 19 Branchen bzw. den zwölf IHK-Regionen Baden-Württembergs. Die Ergebnisse lassen sich auf Wunsch als Grafik oder Excel-Datei aus der Anwendung heraus abspeichern.
Bestehende oder neu gegründete KMU aller Branchen, die wegen fehlender Absicherung Schwierigkeiten haben, Kredite zu erhalten, können eine Bürgschaft bei der Bürgschaftsbank beantragen. Die Bürgschaftsbank bürgt für maximal 70 Prozent der Kreditsumme, bei Existenzgründungsvorhaben sogar bis zu 80 Prozent. Derzeit unterstützt die Bürgschaftsbank mehr als 14.000 Unternehmen mit einem Kredit- und Beteiligungsvolumen von insgesamt mehr als 2,3 Mrd. Euro.
Über das Schwesterinstitut, die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg (MBG), werden KMU aller Branchen direkt mit Kapital in Höhe von bis zu einer Million Euro versorgt. Dies erfolgt in Form von so genannten stillen Beteiligungen, die unternehmerische Unabhängigkeit bleibt dabei also erhalten. Innovative Start-ups begleitet die MBG mit offenen Beteiligungen und erhält damit Mitsprache- und Informationsrechte. Die MBG stellt als einer der häufigsten Beteiligungskapitalgeber in Deutschland rund 260 Millionen Euro Beteiligungskapital für 900 baden-württembergische Unternehmen bereit.
Da die Bürgschaftsbank die MBG unterstützt, indem sie Garantien zwischen 25 und 70 Prozent für MBG-Beteiligungen übernimmt, können Unternehmen hier von einem Finanzierungsangebot aus einer Hand profitieren.
Der Leitfaden Industrie 4.0 unterstützt Unternehmen auf ihrem Weg zu Industrie 4.0. Entwickelt wurde er vom wbk Institut für Produktionstechnik am KIT und dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. sowie vom Fachgebiet Datenverarbeitung in der Konstruktion der TU Darmstadt. Das praxisnahe Instrument zeigt eine stufenweise Entwicklung in verschiedenen Anwendungsebenen auf. Die Ingenieure des wbk untersuchen gemeinsam mit den Unternehmen, was sich in der Produktion verändern könnte und welche Änderungen der Produkte gewünscht sind. Der Leitfaden ermöglicht Unternehmen anhand ihrer aktuellen Produktionssituation konkrete Anwendungen zu identifizieren und Ideen zur Einführung und Umsetzung von Industrie 4.0 zu generieren. Einen Stützpfeiler bildet der Werkzeugkasten des Leitfadens, der die zielgerichtete Entwicklung von Ideen unterstützt. Er visualisiert verschiedene Anwendungsebenen von Industrie 4.0 und zeigt Entwicklungsrichtungen für eigene Produkte beziehungsweise die eigene Produktion auf.

Fördermöglichkeiten für innovative Digitalisierungsvorhaben im produzierenden Gewerbe.
Das Land Baden-Württemberg fördert Lernfabriken sowie die Einführung und Nutzung von Tablets in Berufsschulen für die Bereiche der Mechatronik, der Kraftfahrzeugmechatronik sowie das Büromanagement. Um belastbare und erprobte Ergebnisse zur digitalen Anwendung in der beruflichen Ausbildung zu gewinnen, sollen Modellprojekte entwickelt und exemplarisch umgesetzt werden. Ziele sind u.a. die Qualität und die Attraktivität der Berufsausbildung zu steigern. Die Förderung der ausgewählten Projekte beträgt je Vorhaben 200.000 Euro. Gefördert werden u.a. Hochschulen sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Kooperationsverbünde sind möglich, auch in Kooperation mit Unternehmen.
Die Fördermaßnahme richtet sich an Entwicklungs- und Forschungsvorhaben der Spitzenforschung kleinerer und mittlerer Unternehmen, die auf die Anwendungsfelder Automobil und Mobilität, Maschinenbau und Automatisierung, Gesundheit und Medizintechnik, Logistik und Dienstleistungen, Energie und Umwelt sowie Daten- und IKT-Wirtschaft ausgerichtet sind. Anträge können sowohl als Einzelvorhaben eines KMU oder Verbundvorhaben zusammen mit einer Hochschule oder einem Forschungsinstitut eingereicht werden. Dabei sind Zuwendungen von bis zu 50 Prozent der projektbezogenen Kosten möglich.
Bewerben können sich Netzwerke aus mindestens sechs kleinen und mittelständischen Unternehmen mit Standort/Betriebsstätte in Deuschland sowie möglicher weiterer Partner. Bei internationalen Innovationsnetzwerken müssen mindestens vier KMU und einer Netzwerkmanagementeinrichtung mit Standort in Deutschland sowie mindestens zwei mittelständischen Unternehmen ohne eine Betriebsstätte oder Niederlassung inDeutschland und einer weiteren unterstützenden Einrichtung zusammenerbeiten. Die Beteiligung der mittelständischen Unternehmen ohne Betriebsstätte oder Niederlassung in Deutschland an einem Netzwerk sollte nicht höher als 50 % sein.
Die Managementleistungen sollen die Erschließung von Synergieeffekten zwischen den Netzwerkpartnern unterstützen, dienen zur konzeptionellen Vorbereitung und Umsetzung von FuE-Projekten im Netzwerk, der Koordinierung der FuE-Aktivitäten sowie der Organisation und Weiterentwicklung der Innovationsnetzwerke sowie bei internationalen Netzwerken zur Unterstützung bei der Internationalisierung der Aktivitäten dienen.
Gefördert werden Netzwerkmanagementdienstleistungen und sowie (im separaten Antragsverfahren) Entwicklungsprojekte des Netzwerks. Eine Einschränkung auf bestimmte Technologiefelder und Branchen besteht nicht.
Die Förderung der Netzwerkeinrichtung ist degressiv; dei Fehlbeträge sind durch die Netzwerkmitglieder zu finanzieren.
Das Innovationsgeschehen im Bereich IKT zeigt in Deutschland die spezifische Tendenz, mit IT-Lösungen häufig in der "Komfortzone" einer Marktnische zu verbleiben, die eng auf einzelne Branchen und Entwicklungspartner begrenzt ist. Eine zweite Schwachstelle im Innovationsgeschehen des IKT-Sektors ist die Zurückhaltung aufseiten der akademischen Forschung gegenüber der langfristig ausgerichteten Basisentwicklung für komplexe Querschnittstechnologien. Hierin wird eine mittelbare Folge der unterentwickelten Kooperation der Marktteilnehmer sichtbar, da die akademische Forschung auf verschiedenen Themenfeldern keine praktische Umsetzung und Nutzung solcher Querschnittstechnologien erfährt.
In der Bekanntmachung stehen drei Themen im Vordergrund der laufenden Entwicklung: IKT in komplexen Systemen ("Embedded Systems"), intelligente Lernende Systeme sowie Internet der Dinge und Dienste.
Die Förderlinie B der Bekanntmachung ist auf die Entwicklung von integrativen und konvergenten Lösungen im Verbund von Forschung und Wirtschaft ausgerichtet. Solche werden dann erforderlich, wenn verschiedene erprobte Lösungsansätze im IKT-Sektor, vielfach auch Insellösungen, zu einer zumeist branchenübergreifenden Basistechnologie mit Querschnittscharakter fortentwickelt werden sollen. Dies ist nur durch Technologieallianzen mit gemeinsamen Entwicklungsanstrengungen im Zusammenwirken einer großen Zahl von Beteiligten aus Forschung und Wirtschaft – potentiellen Anbietern und Anwendern – möglich.
Die Bekanntmachung umfasst weiterhin die Förderlinie A zur langfristigen und überwiegend rein akademischen Vorlaufforschung grundsätzlicher innovationsorientierter Fragestellungen.
Bewerben können sich Unternehmen mit Einzelvorhaben aus den Bereichen Industrie 4.0 und Internet der Dinge. Die Projekte werden über ein Jahr mit maximal 100.000 Euro gefördert.
Dr. Sabine Hemmerling
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Projektträger Softwaresysteme und Wissenstechnologien
Rosa-Luxemburg-Str. 2
10178 Berlin
030 67055-736
E-Mail

Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter und Unternehmer zum Thema Digitalisierung in der Produktion.
Das Angebot dient vor allem Unternehmen aus der fertigenden Industrie, die ihre Entwicklungsprozesse digitalisieren möchten. Das betrifft beispielsweise die digitale Produktentwicklung und die digitale Fertigungsplanung. Bei der Herstellung komplexer Produkte kommt der Vorab-Simulation und Visualisierung eine immer größere Bedeutung zu – denn diese helfen entscheidend, Fehler zu vermeiden und Entwicklungsprozesse wettbewerbsfähig zu halten. In Baden-Württemberg betrifft dies viele Unternehmen, die im Maschinen- und Anlagenbau, in der Automobilbranche sowie in der Luft- und Raumfahrt tätig sind.
Vom Megatrend der Digitalisierung sind Unternehmen aller Größen und Wirtschaftszweige gleichermaßen betroffen. Im Gegensatz zu Konzernen und großen Familienunternehmen besteht bei kleinen und mittelständischen Unternehmen jedoch nach wie vor Aufholbedarf bei der Digitalisierung. Diese wettbewerbsentscheidende Entwicklung von KMU wird bisher teilweise noch unzureichend vollzogen. Die Initiative „Digitallotsen“ leistet einen Beitrag dazu, insbesondere KMU bei ihren Digitalisierungsprozessen zu begleiten und zu unterstützen.
In den Sprechstunden können sich interessierte Vertreter von KMU über neue Geschäftsmöglichkeiten und Prozesse der virtuellen Produktentwicklung und Fertigungsplanung erkundigen. Es werden Kontakte zu Ansprechpartnern im Bereich der digitalisierten Entwicklungsprozesse vermittelt und aktuelle Trends im Virtuellen Engineering sowie in Virtual Reality und Augmented Reality aufgezeigt. Die Sprechstunden finden quartalsweise in den folgenden Städten statt: Aalen, Albstadt, Freiburg, Friedrichshafen, Heilbronn, Karlsruhe, Mannheim, Pforzheim, Reutlingen, Schwäbisch Hall, Stuttgart, Sankt Georgen, Tuttlingen und Ulm. Außerdem ist eine individuelle Terminabstimmung möglich.
Das Projekt „Lotsen für die Digitalisierung von Planungs- und Entwicklungsprozessen“ des VDC wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg gefördert. Ziel des Projektes ist es, mittelständische Unternehmen mit geeigneten Maßnahmen bei der Digitalisierung zu unterstützen. Das VDC erarbeitet als Digitallotse weitere Maßnahmen zur konkreten Unterstützung von KMU, beispielsweise einen Virtual-Engineering-Anwendungsatlas und ein digitales Transfer- und Informationssystem. Daneben werden regionale Veranstaltungen zu Digitalisierungsthemen organisiert.
Der Nutzen digitaler Technologien ist für die meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen groß, jedoch können sie oftmals Chancen und Risiken nicht genau einschätzen. Um einen besseren Überblick zu gewinnen und daraus die eigenen Schritte einleiten zu können, eignet sich der Zertifizierungslehrgang zum Digitalisierungsmanager. An drei Wochenenden wird Mitarbeitern von KMU der nötige rechtliche Hintergrund vermittelt, um Digitalisierungsprozesse erfolgreich durchführen zu können. Zudem wird anhand von Best-Practice-Beispielen die Planung und Umsetzung von Digitalisierungsprozessen erlernt. Um das Zertifikat zu erlangen, muss ein Abschlusstest bestanden werden.
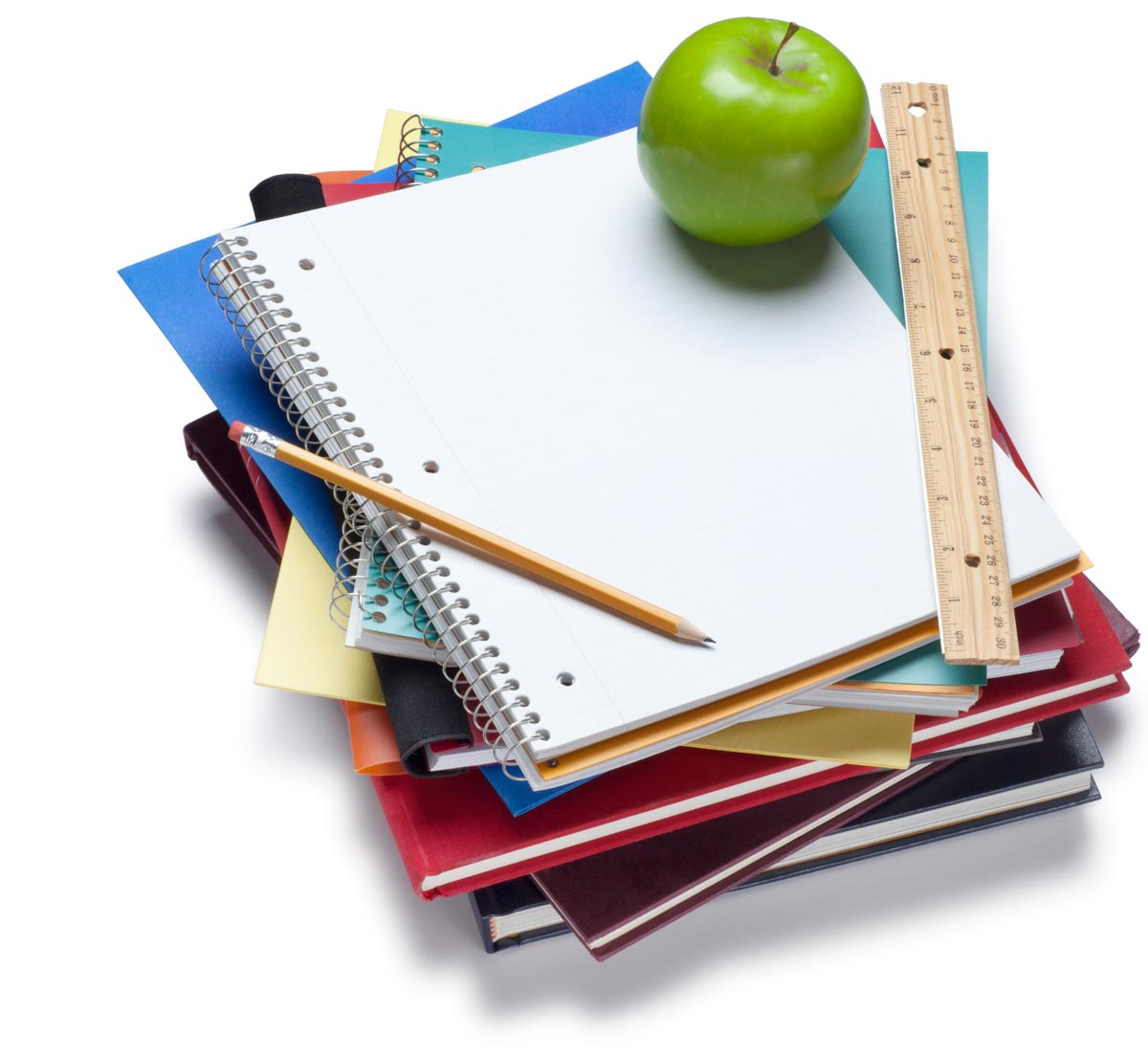
Publikationen und Studien zu Digitalisierungsthemen für Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe.
Technische Regelsetzung bedeutet im Allgemeinen die Erstellung und Herausgabe von Dokumenten wie Normen, Spezifikationen, Leitfäden, Richtlinien oder technischen Berichten unter Einhaltung der dafür vorgesehenen Erarbeitungsprozesse.
Das Einsatzgebiet technischer Regeln ist vielfältig. Sie sind beispielsweise dann erforderlich, wenn gleichartige oder ähnliche Gegenstände, Methoden und Verfahren in unterschiedlichen Anwendungsfällen an verschiedenen Orten von verschiedenen Nutzergruppen zum Einsatz kommen. Sie dienen damit im weitesten Sinne der Vereinheitlichung. Werden die in den technischen Regeln festgelegten Anforderungen eingehalten, was durch unabhängige Prüfinstitute bescheinigt werden kann, lassen sich Produkte, Prozesse und Dienstleistungen untereinander vergleichen, und es ist u. a. ein Mindestniveau an Sicherheit, Austauschbarkeit und Interoperabilität sichergestellt.
Eine technische Norm (kurz: Norm) wird von einer anerkannten Normungsorganisation nach festgelegten WTO-konformen Grundsätzen konsensbasiert erarbeitet. Technische Spezifikationen (kurz: Spezifikation) dagegen werden häufig nach vereinfachten Verfahren erstellt, die eine schnellere Anwendung ermöglichen und deren Festlegungen nicht im Konsens des gesamten Gremiums festgelegt werden müssen. Dabei sollte stets das Ziel sein, die technischen Spezifikationen zu einer Norm weiterzuentwickeln. Die Begriffe Normung bzw. Standardisierung bezeichnen den definierten Prozess, an dessen Ende als Ergebnis eine Norm oder eine Spezifikation zur Verfügung steht.
Die klassischen Werkzeuge zur Geschäftsmodellentwicklung müssen für die Digitalisierung weiterentwickelt werden. Mit dem Toolbook wurde daher der erste Sammelband mit Tools für die Geschäftsmodellentwicklung von Plattformen und digitalen Ökosystemen entwickelt. Praxisorientiert und Schritt für Schritt wird erklärt, wie die verschiedenen Tools angewendet werden. Die Herausgeber haben dafür namhafte Expertinnen und Experten gewonnen, die ihre selbst entwickelten Tools vorstellen oder die eigenen Erfahrungen bei der Anwendung mit den Werkzeuge und Methoden teilen.
Die Produktionstechnik ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Die Digitalisierung der Produktion, oftmals zusammengefasst unter dem Schlagwort Industrie 4.0, stellt die Produktionstechnik vor ganz neue Herausforderungen.Industrie 4.0 induziert umfangreiche qualitative Veränderungen im produzierenden Gewerbe mit signifikanten Auswirkungen auf bestehende und zukünftige Wertschöpfungsketten. Gleichzeitig sind aber gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in sich dynamisch entwickelnden und verändernden Wertschöpfungsketten ein Hauptbetroffener dieses neuen Paradigmas. Es ist daher nicht verwunderlich, dass KMU dem Thema Industrie 4.0 verunsichert gegenüberstehen, da für diese oftmals nicht klar ist, was diese Form des industriellen Transformationsprozesses bedeutet bzw. wann und wie sie diesem am besten begegnen.
Cluster-Initiativen bzw. regionale Netzwerke repräsentieren in der Regel eine signifikante Anzahl von Akteuren einer gesamten Wertschöpfungskette, und haben sich in der Vergangenheit als gutes Instrument erwiesen, Unternehmen in Hinblick auf deren Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit wirkungsvoll zu unterstützen. Viele von diesen haben wirkungsvolle Dienstleistungen und Services im Sinne ihrer Mitglieder, vorwiegend KMU, implementiert, die helfen, zukünftige Entwicklungen richtig einzuschätzen bzw. sich gegenüber Trends angemessen zu positionieren. Können daher Cluster-Initiativen auch im Kontext Industrie 4.0 eine nachhaltige Rolle als Coach und Mittler zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik einnehmen?
An einer ersten Sachstandsanalyse nahmen sieben der leistungsfähigsten Clustermanagements aus Baden-Württemberg teil, welche alle mit dem Baden-Württemberg Exzellenz-Label ausgezeichnet sind. Die Region Baden-Württemberg wurde vor allem deswegen ausgewählt, weil sie im Bereich der Produktionstechnik eine führende Rolle in Deutschland einnimmt.
Im Zeitraum von April 2018 bis April 2019 untersuchten Communication Consultants und VICO Research & Consulting das Kommunikationsverhalten von 350 Mittelständlern aus dem produzierenden Gewerbe der DACH-Region. Wie schon in der Vorjahresstudie zeigte sich, dass Digitalisierung das Netz stark beschäftigt. Während Journalisten, Blogger und User viel über den digitalen Wandel sprechen, greift die Mehrheit der Mittelständler das Thema jedoch nicht aktiv auf. Dabei hätten die Unternehmen eigentlich gute Chancen, in der sehr regen Diskussion rund um den digitalen Wandel ganz vorne mitzumischen und sich als Experten zu positionieren.