Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ist ein zentraler Bestandteil der Digitalisierung und berührt eine Vielzahl von gesellschaftlichen, politischen und sozialen Aspekten. Die Brandbreite reicht dabei von intelligenten Robotern bis hin zu lernfähigen Geräten und Produkten. Grundlage all dessen ist die Fähigkeit der KI, Informationen jeglicher Art – beispielsweise Sprach- und Gestensteuerung oder sonstige Daten – zu verarbeiten und intelligent darauf zu reagieren. Daraus ergeben sich zahlreiche revolutionäre Möglichkeiten für Erfindungen, die das Leben von Morgen prägen werden.
Die Erwartungen an die Potenziale der KI sind dementsprechend hoch, beispielsweise kann die KI dem Menschen dabei helfen, seine Aufgaben und Tätigkeiten schneller, einfacher und spielerisch zu bewältigen. In der Tat werden bereits heute KI-Technologien an verschiedenen Einsatzgebieten, wie Smart-Home-Anwendungen jeglicher Art oder VR-Technologien in der Gaming-Branche, verwendet.
Aber auch die Skepsis gegenüber derartigen industriellen Neuerungen ist nach wie vor groß. Was ist also von intelligenten Systemen und den Auswirkungen der KI auf unser Leben zu erwarten?
Künstliche Intelligenz – Versuch einer Definition
Schon die Abgrenzung des Begriffs „künstliche Intelligenz“ ist schwer, denn eine eindeutige Definition ist nicht ohne weiteres darzulegen. In der Praxis wird von einem System mit KI eine größtmögliche Annäherung an das Verhalten erwartet, das Wesen mit natürlicher Intelligenz wie beispielsweise Menschen auszeichnet. Folgende Fähigkeiten sind dabei wichtig: Die Wahrnehmung der Umwelt, die Verarbeitung dieser Eindrücke sowie darauf aufbauend das Treffen von Entscheidungen, die Interaktion mit der Umwelt und die Lösung von Problemen. Zentral ist zudem die Fähigkeit, aus den Konsequenzen der eigenen Entscheidungen und des eigenen Handelns selbstständig zu lernen. Ebendies unterscheidet KI-Systeme von bisherigen Erfindungen.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten von KI
Bekannte Anwendungsbeispiele von KI-Technologien sind zum Beispiel neue App-Technologien, die als Assistenzsysteme mit intelligenter Sprach- und Gestensteuerung dienen. Ein Beispiel hierfür ist das so genannte Ambient Assisted Living. Hierunter fallen Systeme, Produkte sowie Dienstleistungen, welche das alltägliche Leben älterer und auch benachteiligter Menschen unterstützen. Beispielsweise indem sie Tätigkeiten im Haushalt per Sprachbefehl übernehmen oder eine grundlegende medizinische Versorgung sicherstellen. Auch aus dem Bereich Smart Home sind zahlreiche Möglichkeiten für den Einsatz von KI denkbar: So können intelligente Systeme Heizung, Rollläden und alle technischen Geräte im Haus untereinander vernetzen und steuern. Zu den bekanntesten Einsatzmöglichkeiten in der Industrie zählt die so genannte Predictive Maintenance, also die Vorhersage und Vorbeugung von Ausfällen von Produktionsanlagen oder intelligenten Robotik Systemen.
Grenzen und Herausforderungen der KI
Eine Hürde bis zur vollständigen Anwendung von KI-Systemen stellt die technische Machbarkeit dar, denn die heutigen Systeme können auf komplett neue Situationen und veränderte Anforderungen meist nur mit starken Einschränkungen reagieren. Zudem sind noch nicht alle Entscheidungen nachvollziehbar, zu denen intelligente Systeme gelangen. Das macht es beispielsweise schwierig zu ermitteln, warum ein System etwa eine falsche Entscheidung getroffen hat. Der aktuelle Forschungs- und Entwicklungstrend geht daher in die Richtung, aus den erkannten Mustern und Prozessinformationen Entscheidungspfade abzuleiten, die für den Menschen nachvollziehbar sind.
Außerdem herrschen nach wie vor einige Bedenken gegenüber KI-Systemen. Die Befürchtung, dass Arbeitsplätze verschwinden und Tätigkeiten vollständig von Maschinen und Robotern übernommen werden, schreckt große Teile der Bevölkerung ab. KI-System sollten aber viel mehr als intelligente Assistenzsysteme für den Menschen und weniger als kannibalisierende Technologie interpretiert werden. Hier sind Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in der Pflicht, den Nutzen sowie Chancen und Potenziale von KI zu kommunizieren.
Denn auch wenn noch diverse Herausforderungen überwunden werden müssen, wird die KI die Zukunft voraussichtlich maßgeblich beeinflussen. Deshalb sollte die KI als große Chance für Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft gesehen werden und proaktiv mitgestaltet werden.

Serviceangebote
Weitere ServiceangeboteInformationen und Beratung zum Thema künstliche Intelligenz.
Weitere Informationen zur Lernfabrik 4.0 Bietigheim-Bissingen finden Sie hier.
Den Film finden Sie hier.
Förderprogramme
Weitere FörderprogrammeFördermöglichkeiten für Maßnahmen im Bereich künstliche Intelligenz.
Um dies zu erreichen, identifizierte die EU-Kommission fünf Handlungsfelder in ihrem Digital Europe Programme: Künstliche Intelligenz und Datenwirtschaft, Hochleistungsrechner, Cybersicherheit, Fortgeschrittene digitale Kompetenzen, Breiter Einsatz digitaler Technologien in Wirtschaft und Gesellschaft.
Weitere Informationen:
Digital Europe Programme | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)/
Cybersicherheit im Digital Europe Programme
Bundesministerium für Digitales und Verkehr - Bundesministerium für Digitales und Verkehr
digital-europe@bmdv.bund.de
Ansprechpartner Cybersicherheit
Stefan Hillesheim
+49 228 3821 2230
stefan.hillesheim@dlr.de
Dr. Marvin Richter
+49 228 3821 2147
marvin.richter@dlr.de
Dr. Alexander Khanin
+49 228 3821 2667
alexander.khanin@dlr.de
Ansprechpartner im Land u.a. EDIH, Enterprise Europe Network
steinbeis-europa.de/de/foerderungen/digital-europe-programme
enterprise-europe-bw.de/ueber-uns/ansprechpartner/
Hanna Schaefer
Steinbeis Europa Zentrum
hanna.schaefer@steinbeis-europa.de +4971125242035
Der EIC vergibt jährlich 3 Mal jeweils 100.000 Euro an inspirierende Gründerinnen innovativer Unternehmen. Zusätzlich wird jährlich eine Gründerin, die maximal 30 Jahre alt ist, als „Rising Innovator“ mit 50.000 Euro ausgezeichnet. Zur Bewerbung muss ein Antrag bestehend aus einem Fragebogen und einem Video eingereicht werden, die darüber ausgewählten Semi-Finalistinnen müssen sich darüber hinaus im persönlichen Interview vor einer Jury beweisen. Die Deadlines für die Bewerbung entnehmen Sie bitte der offiziellen Webseite des Preises der EU.
Start-ups und KMU aus Baden-Württemberg erhalten Informationen und Unterstützung für Anträge. Weitere Hinweise finden der Webseite ="http://www.innocheck-bw.de">www.innocheck-bw.de des Unterstützungsprojekts für Start-ups und KMU beim Steinbeis Europa Zentrum, gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte ebenfalls der Webseite des Unterstützungsprojekts.
Ziel dieses Förderprogramms ist die Weiterentwicklung von Ideen aus bereits bestehenden EU-geförderten Projekten. Notwendig ist ein Vorprojekt aus den Förderprogrammen „EIC Pathfinder“, „FET“ oder „ERC Proof of Concept“, in dem die Realisierbarkeit einer bahnbrechenden Technologie im Labor nachgewiesen wurde (Technologiereifegrad 3). Von diesem ausgehend soll die Marktreife erhöht und ein Demonstrator in relevanten Einsatzumgebungen entwickelt werden. Anträge können allein oder in Konsortien aus 2 bis 5 Mitgliedern gestellt werden.
Es gibt themenoffene Aufrufe (Transition Open) und auf bestimmte Herausforderungen fokussierte Aufrufe (Transition Challenges). Hilfe und Hinweise finden Sie in den FAQ der Webseite www.innocheck-bw.de des Unterstützungsprojekts für Start-ups und KMU beim Steinbeis Europa Zentrum, gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte ebenfalls der Webseite des Unterstützungsprojekts.
Calls u.a. www.steinbeis-europa.de/de/leistungen/eu-foerderung
Über einen Innovationsgutschein förderfähig sind zum Beispiel Recherchen und Machbarkeitsstudien, Material- oder Designuntersuchungen oder auch der Bau von Prototypen und Tests zur Sicherstellung von Qualität oder Umweltverträglichkeit. Anders als bisher gibt es nicht mehr fünf, sondern nur noch drei Gutscheinlinien: Innovationsgutschein BW (maximal 7.500 Euro Zuschuss bei einem Fördersatz von 50 Prozent), Innovationsgutschein Hightech BW (maximal 20.000 Euro Zuschuss bei einem Fördersatz von 50 Prozent), Innovationsgutschein Start-up BW (maximal 20.000 Euro Zuschuss bei einem Fördersatz von 50 Prozent).
Bildungsangebote
Weitere BildungsangeboteWeiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeitende und Unternehmer:innen zum Thema künstliche Intelligenz.
Eingerichtet an beruflichen Schulen dienen sie in erster Linie der Vorbereitung von Fach- und Nachwuchskräften auf die Anforderungen der Industrie 4.0, indem sie Auszubildende und Teilnehmer an Weiterbildungskursen an die Bedienung von Anlagen auf Basis realer Industriestandards heranführen. Die Lernfabriken helfen dabei, das abstrakte Konzept von Industrie 4.0 für Nachwuchskräfte und Beschäftigte greifbar zu machen.
Studien
Weitere StudienPublikationen und Studien zu Digitalisierungsthemen im Bereich künstliche Intelligenz.
Künstliche Intelligenz hat die Forschungslabore verlassen und durchdringt atemberaubend schnell Alltag und Arbeitswelt in Form sprechender Geräte und digitaler Assistenten, kooperativer Roboter, autonomer Fahrzeuge und Drohnen. Das Smart Data Forum machte Ergebnisse aus der deutschen und internationalen Spitzenforschung für den Mittelstand leicht zugänglich und hilft bei der erfolgreichen Umsetzung innovativer Digitalisierungskonzepte und Technologien in der unternehmerischen Praxis.
Beispiele aus neun Einsatzbereiche werden vorgestellt und abhängig von der Aufgabe und den verarbeiteten Daten weiter untergliedert. Der Beispielsammlung vorangestellt sind ein kurzer Abriss zur Geschichte der Künstlichen Intelligenz, die wichtigsten Konzepte des Maschinellen Lernens als aktuelle Schlüsseltechnologie für intelligente Lösungen und ein Ausblick auf Trends in der Forschung.
Die präsentierten Ergebnisse basieren außerdem auf weiteren, bei Fraunhofer im Jahr 2017 beauftragten Analysen des Marktes, des Forschungsgebietes und der Ausbildungssituation.
Bereits heute gelten HMI als Aushängeschild und Treiber für positive Nutzererlebnisse und stellen als fester Bestandteil des Maschinendesigns einen wesentlichen Wettbewerbsfaktor dar. Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen bei der konsequenten Ausrichtung ihrer Prozesse, Produkte und Geschäftsmodelle an die Bedingungen einer vernetzten digitalen Welt jedoch vor großen Herausforderungen.
Die vorliegende Studie ist Teil einer Studienreihe des Business Innovation Engineering Centers (BIEC) und unterstützt Unternehmen – insbesondere KMU – bei der Entwicklung von HMI. Dabei können Entwickler auf verschiedene digitale Werkzeuge zurückgreifen, aus welchen es das für einen konkreten Anwendungsfall Passende zu wählen gilt. Die Studie bietet Entscheidern und Entwicklern dazu zunächst einen Überblick über den aktuellen Stand von am Markt erhältlichen HMI-Lösungen. Darüber hinaus werden konkrete Entscheidungskriterien vorgestellt, praxisrelevantes Wissen zur Gestaltung von Nutzererlebnissen vermittelt und so eine systematische Orientierungshilfe beim Design- und Entwicklungsprozess gegeben.
Jeder kennt das »Periodensystem der Elemente« aus dem Chemieunterricht. Das Periodensystem ist ein intuitiver und schneller »Lego-Baukasten«, der uns unterstützt, komplizierte Zusammenhänge zwischen Bausteinen (Atomen) und Molekülen (Naturstoffe, Steine oder Metalle) intellektuell zu erfassen.
Der amerikanische Informatiker Kristian Hammond hat den Versuch unternommen, eine Lingua Franca für künstliche Intelligenz zu konzipieren. In Anlehnung an die Chemie bezeichnet er sie als »Periodensystem der Künstlichen Intelligenz«. Das Periodensystem der Künstlichen Intelligenz unterstützt dabei, den Begriff KI auf Geschäftsprozesse abzubilden und ein Verständnis der Elemente aufzubauen – ähnlich wie im Periodensystem der chemischen Elemente. Der Ansatz hilft beim Verständnis und bei der Einschätzung von Marktreife, Aufwänden, benötigtem Maschinentraining sowie Wissen und Erfahrungen der Mitarbeiter.
Die Studie stellt die wichtigsten Konzepte und Methoden des Maschinellen Lernens vor, gibt einen Überblick über Herasuforderungen der Technologie und zeigt neue Forschungsfelder auf. Außerdem wird der Standort Deustchland näher vorgestellt, indem Rahmenbedingungen sowie relevante Märkte und Branchen thematisiert werden.
Digitalisierung in Zahlen! Der Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2018 des Bundes-wirtschaftministeriums liefert einen umfassenden Überblick über die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft.
Dabei wird anhand der Zahlen zwischen 0 und 100 angegeben, weit die Digitalisierung in der gesamten deutschen Wirtschaft sowie in unterschiedlichen Branchen, Teilbereichen und Unternehmensgrößen fortgeschritten ist, und wie sie voraussichtlich sich bis 2023 verändern wird. Von zentraler Bedeutung sind dabei folgende drei Themen: Die Nutzung digitaler Geräte, der unternehmensinterne Digitalisierungsgrad sowie die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Unternehmen.
Über den Index hinaus identifiziert der Bericht auch aktuelle Trends und Herausforderungen für die Wirtschaft. Schwerpunktthema dieser Ausgabe ist die Nutzung Künstlicher Intelligenz. Grundlage für den Index ist die Befragung hochrangiger Entscheider aus 1.061 Unternehmen in Deutschland.



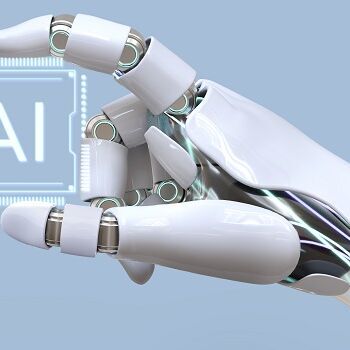

 +49 7131 504 6687
+49 7131 504 6687 zml@hs-heilbronn.de
zml@hs-heilbronn.de Webseite
Webseite







