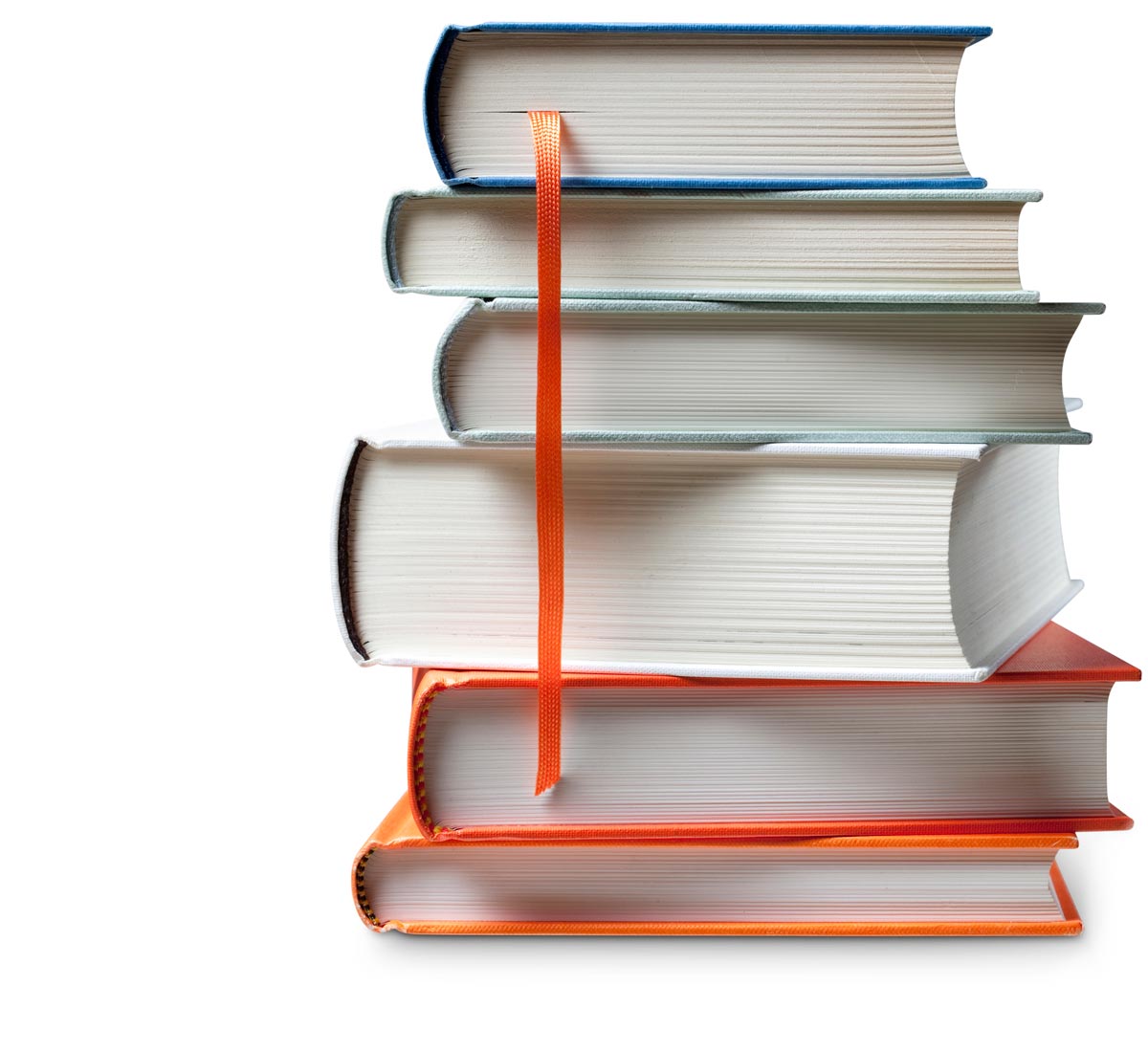Digitaler Wandel im Dienstleistungssektor.

Für Dienstleister steht im allgemeinen eine erbrachte Leistung im Vordergrund und nicht die materielle Produktion beziehungsweise der Wert des gegenständlichen Endproduktes. Tätigkeiten im Dienstleistungssektor sind traditionell weniger technisiert, da sie häufig nicht an einen festen Standort (wie etwa bei der Industrie) gebunden werden können. Zudem sind sie wissensintensiv, erfordern Flexibilität und bauen auf die Interaktion zwischen Menschen auf. Das trifft jedoch nicht auf alle Bereiche zu: Das beste Beispiel ist die Büroarbeit, die in der Vergangenheit viele technologische Neuerungen übernommen hat und schwer ohne den Einsatz von Computern denkbar wäre.
Auch der Dienstleistungssektor profitiert von der digitalen Transformation. Das zeigt sich beispielsweise bei Recherche-, Buchhaltungs- und Beratungstätigkeiten, wie etwa Reisen oder Finanzdienstleistungen, die mittlerweile überwiegend digital und von den Kunden selbst erledigt werden können. Gleichzeitig entstehen neue Geschäftsmodelle im Dienstleistungsbereich, etwa in der so genannten Sharing Economy, die auf dem systematischen Ausleihen bzw. Bereitstellen von Räumlichkeiten und Objekten basiert. So gibt es heutzutage beispielsweise in jeder größeren Stadt ein Angebot für „Car Sharing“, bei dem sich Personen Autos für den Stadtverkehr teilen.
Zwar werden durch die Digitalisierung einige Dienstleistungen an Bedeutung verlieren oder voraussichtlich verschwinden, gleichzeitig können andere durch neue Technologien verbessert und ausgebaut oder ganz neue Geschäftsmodelle geschaffen werden. Ebenso wie bei den anderen Zielgruppen ermöglicht es die Digitalisierung darüber hinaus, Verwaltungs- und Routineaufgaben zu automatisieren und durch neue Vertriebswege einen breiten Kreis von Kunden zu erreichen.

Informationen und Beratung zu Digitalisierungsthemen für Dienstleistungsunternehmen.
Bestehende oder neu gegründete KMU aller Branchen, die wegen fehlender Absicherung Schwierigkeiten haben, Kredite zu erhalten, können eine Bürgschaft bei der Bürgschaftsbank beantragen. Die Bürgschaftsbank bürgt für maximal 70 Prozent der Kreditsumme, bei Existenzgründungsvorhaben sogar bis zu 80 Prozent. Derzeit unterstützt die Bürgschaftsbank mehr als 14.000 Unternehmen mit einem Kredit- und Beteiligungsvolumen von insgesamt mehr als 2,3 Mrd. Euro.
Über das Schwesterinstitut, die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg (MBG), werden KMU aller Branchen direkt mit Kapital in Höhe von bis zu einer Million Euro versorgt. Dies erfolgt in Form von so genannten stillen Beteiligungen, die unternehmerische Unabhängigkeit bleibt dabei also erhalten. Innovative Start-ups begleitet die MBG mit offenen Beteiligungen und erhält damit Mitsprache- und Informationsrechte. Die MBG stellt als einer der häufigsten Beteiligungskapitalgeber in Deutschland rund 260 Millionen Euro Beteiligungskapital für 900 baden-württembergische Unternehmen bereit.
Da die Bürgschaftsbank die MBG unterstützt, indem sie Garantien zwischen 25 und 70 Prozent für MBG-Beteiligungen übernimmt, können Unternehmen hier von einem Finanzierungsangebot aus einer Hand profitieren.
Die Digital-Experten analysieren, optimieren und unterstützen die Unternehmensprozesse, Technologien, Produkte und Geschäftsmodelle ganz nach den Bedarfen der lösungssuchenden KMU. Die DIZ Digitalsierungs-Experten zeichnen sich durch Ihre Kompetenz, Ihre Branchenerfahrung und Ihre Expertise aus. Das DIZ steht hierbei als neutrales Kompetenzzentrum an Ihrer Seite und unterstützt bei der Auswahl eines passenden Experten.
Um den Beratungsbedarf bei KMU zum Thema Industrie 4.0 ermitteln zu können, hat die ClusterAgentur BW mit dem VDC Fellbach ein Erstberatungstool entwickelt. Dazu wird ein standardisiertes Interview geführt. Mit der Analyse der Ergebnisse können die Clustermanager den befragten Unternehmen passgenaue Hinweise zu Experten, Fördermöglichkeiten und anderen Unterstützungsangeboten geben. So sollen KMU die Möglichkeit eröffnet werden, sich zielgerichtet und eingehender mit dem Thema zu befassen.
Der Innovationsberater des Geschäftsbereichs Innovation & Umwelt berät mittelständische Betriebe zum Thema IT-Sicherheit und bietet zudem eine Rechtsberatung zum Thema Datenschutz.
Ergänzend zum Ideencheck über innocheck-bw informiert das Steinbeis Europa Zentrum regelmäßig in kostenfreien Webseminaren zu den neuen Förderinstrumenten der EU. Für kleine und mittlere Unternehmen aus Baden-Württemberg werden außerdem kostenfreie Trainings zur EU-Antragstellung und dem Bewerbungsprozess für den EIC Accelerator im Europäischen Innovationsrat angeboten.

Fördermöglichkeiten für Fördermöglichkeiten für innovative Digitalisierungsvorhaben im Dienstleistungssektor.
Über einen Innovationsgutschein förderfähig sind zum Beispiel Recherchen und Machbarkeitsstudien, Material- oder Designuntersuchungen oder auch der Bau von Prototypen und Tests zur Sicherstellung von Qualität oder Umweltverträglichkeit. Anders als bisher gibt es nicht mehr fünf, sondern nur noch drei Gutscheinlinien: Innovationsgutschein BW (maximal 7.500 Euro Zuschuss bei einem Fördersatz von 50 Prozent), Innovationsgutschein Hightech BW (maximal 20.000 Euro Zuschuss bei einem Fördersatz von 50 Prozent), Innovationsgutschein Start-up BW (maximal 20.000 Euro Zuschuss bei einem Fördersatz von 50 Prozent).
Mit der Digitalisierungsprämie Plus werden konkrete Projekte zur Einführung neuer digitaler Lösungen sowie zur Verbesserung der IT-Sicherheit in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) gefördert. Die Digitalisierungsprämie Plus soll den im Zuge der Corona-Pandemie entstandenen Digitalisierungsschub fortsetzen und verstärken. Gefördert wird vor allem die Einführung neuer digitaler Systeme der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) für Produkte, Dienstleistungen, Prozesse, Verbesserung der IKT-Sicherheit sowie Künstliche-Intelligenz-Anwendungen. Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) unterstützt beispielsweise dabei, Prozesse effizienter zu gestalten, neue Produkte und Dienstleistungen einzuführen oder innovative Geschäftsmodelle umzusetzen.
Die Unternehmen können je nach Projektvolumen zwischen zwei Programmvarianten wählen:
Digitalisierungsprämie Plus - Darlehensvariante (zinsverbilligtes Darlehen mit Tilgungszuschuss)
In der Zuschussvariante wird die Antragstellung über die L-Bank, in der Darlehensvariante über die Hausbank des Antragstellers erfolgen.
Der EIC vergibt jährlich 3 Mal jeweils 100.000 Euro an inspirierende Gründerinnen innovativer Unternehmen. Zusätzlich wird jährlich eine Gründerin, die maximal 30 Jahre alt ist, als „Rising Innovator“ mit 50.000 Euro ausgezeichnet. Zur Bewerbung muss ein Antrag bestehend aus einem Fragebogen und einem Video eingereicht werden, die darüber ausgewählten Semi-Finalistinnen müssen sich darüber hinaus im persönlichen Interview vor einer Jury beweisen. Die Deadlines für die Bewerbung entnehmen Sie bitte der offiziellen Webseite des Preises der EU.
Start-ups und KMU aus Baden-Württemberg erhalten Informationen und Unterstützung für Anträge. Weitere Hinweise finden der Webseite ="http://www.innocheck-bw.de">www.innocheck-bw.de des Unterstützungsprojekts für Start-ups und KMU beim Steinbeis Europa Zentrum, gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte ebenfalls der Webseite des Unterstützungsprojekts.
Das Land Baden-Württemberg fördert Lernfabriken sowie die Einführung und Nutzung von Tablets in Berufsschulen für die Bereiche der Mechatronik, der Kraftfahrzeugmechatronik sowie das Büromanagement. Um belastbare und erprobte Ergebnisse zur digitalen Anwendung in der beruflichen Ausbildung zu gewinnen, sollen Modellprojekte entwickelt und exemplarisch umgesetzt werden. Ziele sind u.a. die Qualität und die Attraktivität der Berufsausbildung zu steigern. Die Förderung der ausgewählten Projekte beträgt je Vorhaben 200.000 Euro. Gefördert werden u.a. Hochschulen sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Kooperationsverbünde sind möglich, auch in Kooperation mit Unternehmen.
Um dies zu erreichen, identifizierte die EU-Kommission fünf Handlungsfelder in ihrem Digital Europe Programme: Künstliche Intelligenz und Datenwirtschaft, Hochleistungsrechner, Cybersicherheit, Fortgeschrittene digitale Kompetenzen, Breiter Einsatz digitaler Technologien in Wirtschaft und Gesellschaft.
Weitere Informationen:
Digital Europe Programme | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)/

Publikationen und Studien zu Digitalisierungsthemen für Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor.
Die Dynamik der Veränderungen, die eine zunehmende Digitalisierung für Industrie und Dienstleistungssektor mit sich bringt, stellt für die Wirtschaft eine Herausforderung dar, erst recht aber für die Rechtsprechung. Traditionelle Produktionsverfahren und Geschäftsmodelle werden durch die intelligente Vernetzung von Maschinen und Menschen ebenso disruptiv verändert, wie die darauf basierenden globalen, sehr oft Branchengrenzen überschreitenden Wertschöpfungsnetzwerke. Das Idealbild der digitalen Produktion ist durch einen hohen Automatisierungsgrad, schnelle Reaktionszeiten und optimale Prozessabläufe geprägt.
Diese "schöne neue Welt der Wertschöpfung" enthält neben vielen Chancen für mehr Produktivität und verbesserten Leistungsangeboten auch eine Reihe von Herausforderungen, die es zu beachten gilt, wenn neuartige Geschäftsmodelle erfolgreich zur Umsetzung gebracht werden sollen. Nur durch ein inhaltliches Grundverständnis der technisch gesteuerten, autonom realisierten Abläufe können Rechtsexperten mögliche Anwendungsoptionen für Rechtsnormen erkennen. Gleichzeitig können technische Systeme nur durch ein Mindestmaß an Sensibilität für juristische Fallstricke erfolgreich in Geschäftsmodelle überführt werden. Des Weiteren darf die vage Befürchtung möglicher Risiken nicht zur Innovationsbremse werden. Das Vermeiden möglicher Produktions- und Wertschöpfungsoptimierungen aufgrund unklarer Einschätzung der rechtlichen Auswirkungen wäre im internationalen Wettbewerb fatal.
Daher widmet sich dieser Leitfaden auch der internationalen Einordnung von Risiken in bestehende Rechtsnormen. Eine rechtliche Bewertung möglicher Risiken bedarf eindeutiger Beschreibungen von Prozessszenarien und der Rolle einzelner Akteure. Grundsatzfragen der Haftung für entstandene Fehler, Sachschäden oder für Verletzungen müssen durch Präzedenzfälle aus der realen Praxis entschieden werden. Erst wenn daraus anwendbare Rechtsnormen entstehen, sind Mensch-Technik-Kooperationen juristisch sicher gestaltbar.
Die beiden aktuellen Referenzarchitekturmodelle für Industrie 4.0, nämlich RAMI und IIRA, werden eingeführt. Außerdem werden die grundlegenden Standards und Normen für Software-Komponenten in vernetzten Industrieanlagen benannt. Softwarearchitekten und Systementwicklern gibt der Leitfaden damit eine Orientierung für den Umgang mit den heterogenen IT-Technologien in Industrie 4.0 und für die Gestaltung von sicheren Softwarearchitekturen in diesem anspruchsvollen Umfeld.
Beide Referenzarchitekturen verfolgen ein gemeinsames Ziel: die Schaffung eines einheitlichen Ordnungsschemas mit einer wohldefinierten Terminologie, das eine Grundlage für ein gemeinsames Verständnis zwischen verschiedenen Stakeholdern bei der Entwicklung von komplexen Technologien bietet. Generell könnte die Weiterentwicklung der Referenzarchitekturen durch eine interaktive, web-basierte Umgebung gefördert werden. Eine solche interaktive Umgebung, z. B. im Rahmen der Plattform Industrie 4.0, würde eine Möglichkeit bieten, sich mit ähnlich aufgestellten Projekten zu vernetzen, eine gemeinsame Strukturierung der technologischen Lösungen durch die Einordnung in RAMI 4.0 (bzw. IIRA 1.7) vorzunehmen und voneinander in der Entwicklung und Wiederverwendung von Technologien und bereits bestehenden Konzepten oder auch Geschäftsmodellen zu profitieren.
Der "Monitoring-Report - Wirtschaft DIGITAL Baden-Württemberg" wurde im Auftrag des Wirtschaftsministeriums vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und Kantar TNS exklusiv erstellt. Im Rahmen der Erstellung der Studie wurde im Herbst 2017 die Führungsebene von 1.145 Unternehmen in Baden-Württemberg nach ihrer aktuellen Einschätzung und ihrer Prognose für das Jahr 2022 bezüglich des Fortschritts bei der Digitalisierung befragt. Die Ergebnisse - hier speziell für die Finanz- und Versicherungswirtschaft - bilden demnach hinsichtlich Gegenwart und Zukunft die Einschätzungen der Befragten ab.
Die klassischen Werkzeuge zur Geschäftsmodellentwicklung müssen für die Digitalisierung weiterentwickelt werden. Mit dem Toolbook wurde daher der erste Sammelband mit Tools für die Geschäftsmodellentwicklung von Plattformen und digitalen Ökosystemen entwickelt. Praxisorientiert und Schritt für Schritt wird erklärt, wie die verschiedenen Tools angewendet werden. Die Herausgeber haben dafür namhafte Expertinnen und Experten gewonnen, die ihre selbst entwickelten Tools vorstellen oder die eigenen Erfahrungen bei der Anwendung mit den Werkzeuge und Methoden teilen.
Der Siegeszug der Robotik in Produktionsumgebungen ist nicht mehr aufzuhalten. Nicht zuletzt die rasante Entwicklung der Robotik hat einen großen Anteil an der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Glaubt man den Experten, steht uns nun nach einem halben Jahrhundert der dominanten Industrierobotik ein halbes Jahrhundert der Servicerobotik bevor. Die Zahlen belegen diesen Trend.
Im Vordergrund stehen hier die Zahlen für Servicerobotikprodukte im Bereich Militär, Sicherheit, Überwachung,Reinigung und mobile Plattformen. Hieraus kann zumindest für Serviceroboter zur Überwachung und Intervention sowie autonom agierende Serviceroboter ein spürbares Marktwachstum in den nächsten zehn Jahren abgeleitet werden.
Aber nicht nur die Zahlen belegen das wirtschaftliche Potenzial der Servicerobotik. In einer durch den demographischen Wandel beständig älter werdenden Gesellschaft gewinnt die Rolle assistierender Serviceroboter sowohl im privaten als auch betrieblichen Kontext zunehmend an Bedeutung. Im Jahr 2035 wird in Deutschland mehr als die Hälfte der Bevölkerung 50 Jahre oder älter und jeder Dritte älter als 60 Jahre sein. Qualifizierte Mitarbeiter werden ein knappes Gut. Daher ist zu erwarten, dass der Servicerobotik eine wesentliche Rolle in der industriellen Produktion zufallen wird, um die wachsende demographische Lücke zu füllen.
Diese Publikation wurde im Rahmen der Begleitforschung zum BMWi-Förderprogramm AUTONOMIK erstellt.