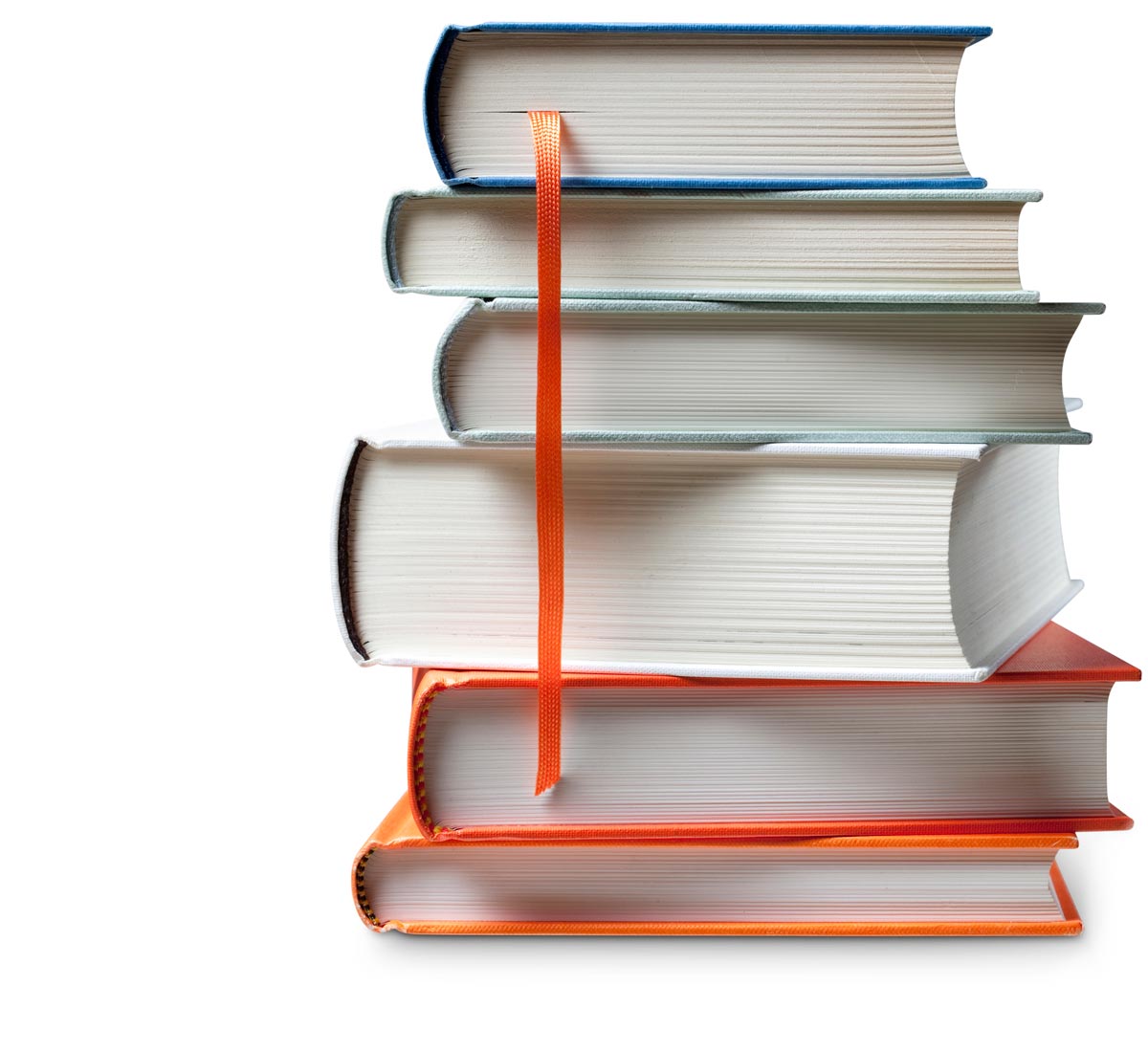Instrument der Innovationsförderung über die innerbetrieblichen Prozesse hinaus

Mit der Digitalisierung und immer kürzeren Innovationszyklen Schritt zu halten, ist eine große Herausforderung für Unternehmen. Deshalb wird die fortlaufende Vernetzung, der Austausch von Wissen und der Technologietransfer, sowie die stetige Kompetenzentwicklung, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit begrenzten Ressourcen, immer wichtiger, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Es hat sich gezeigt, dass der Austausch von Wissen und Technologien zwischen Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Branchen und Sektoren sowie der öffentlichen Verwaltung einen großen Mehrwert für die Innovationsfähigkeit darstellt. Insbesondere dort, wo Experten unterschiedlicher Fachrichtungen zusammentreffen, können disruptive Ideen entstehen und Horizonte erweitert werden. Von Bedeutung ist hier auch die grundlegende Öffnung des Innovationsprozesses im Sinne einer Open-Innovation-Strategie.
Technologie- und Wissenstransfer lässt sich auf vielfältige Art und Weise nutzen und fördern. Dank der digitalen Transformation entstehen auch neue, virtuelle und effizientere Möglichkeiten, miteinander in den Austausch zu kommen. Insgesamt hat sich eine große Anzahl unterschiedlicher virtueller und physischer Transferangebote entwickelt, die Wissen vermitteln oder unterschiedlichste Akteure vernetzen: von Tutorials & Trainings, Weiterbildungen, Kooperationsbörsen, über Wissenschaft-Wirtschaft-Arbeitskreise, Crowdsourcing-Angebote, regionale Cluster-Initiativen sowie themen- und technologiebezogene Hubs und Labore, bis hin zu Veranstaltungen und Messen.
Das Land Baden-Württemberg betrachtet den Technologie- und Wissenstransfer als zentrales Instrument, mit dem Unternehmen innerbetrieblich und darüber hinaus Prozesse optimieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit durch neue Produkte, Services und Geschäftsmodelle stärken können. In diesem Rahmen stellt auch das Land eine große Bandbreite an Transferangeboten zur Verfügung, in deren Rahmen für diverse Branchen, von der industriellen Produktion über das Handwerk bis hin zum Handel aktuelles Wissen zu wichtigen Technologien, wie der Künstlichen Intelligenz, vermittelt wird. Grundsätzlich wird sich der Transfer auch zukünftig immer stärker digitalisieren, sodass virtuelle Kommunikationswege, Plattformen und Formate stärker in den Fokus rücken. Gerade die Digitalisierung des Transfers wird dazu beitragen, über das bisher Bekannte hinaus neue Transferangebote zu entwickeln und den Zugriff auf wichtiges Expertenwissen in den verschiedensten Branchen- und Technologiefeldern auch für neue Nutzergruppen zu erleichtern.

Fördermöglichkeiten für Maßnahmen im Bereich Technologietrends und Wissenstransfer
Gefördert werden während der Modellprojektphase bis Ende 2019 Handwerksfachverbände, welche die Austauschgruppen organisieren. Die Gruppen bestehen aus je 8-15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Geplant sind zwei Treffen pro Jahr. Dabei soll nicht nur der Wissenstransfer zwischen den Betrieben verstärkt werden: Durch die gemeinsamen Diskussionsrunden entstehen auch neue Kooperationsmöglichkeiten. Gefördert werden Gruppen mit den Themenschwerpunkten Personal, strategische Unternehmensführung, Digitalisierung, Innovation und Kooperation. Die Fördersumme beträgt von 3.000 Euro bis zu 4.500 Euro, wodurch Kosten für externe Referentinnen und Referenten sowie Moderatorinnen und Moderatoren gedeckt werden sollen.
Bewerben können sich Netzwerke aus mindestens sechs kleinen und mittelständischen Unternehmen mit Standort/Betriebsstätte in Deuschland sowie möglicher weiterer Partner. Bei internationalen Innovationsnetzwerken müssen mindestens vier KMU und einer Netzwerkmanagementeinrichtung mit Standort in Deutschland sowie mindestens zwei mittelständischen Unternehmen ohne eine Betriebsstätte oder Niederlassung inDeutschland und einer weiteren unterstützenden Einrichtung zusammenerbeiten. Die Beteiligung der mittelständischen Unternehmen ohne Betriebsstätte oder Niederlassung in Deutschland an einem Netzwerk sollte nicht höher als 50 % sein.
Die Managementleistungen sollen die Erschließung von Synergieeffekten zwischen den Netzwerkpartnern unterstützen, dienen zur konzeptionellen Vorbereitung und Umsetzung von FuE-Projekten im Netzwerk, der Koordinierung der FuE-Aktivitäten sowie der Organisation und Weiterentwicklung der Innovationsnetzwerke sowie bei internationalen Netzwerken zur Unterstützung bei der Internationalisierung der Aktivitäten dienen.
Gefördert werden Netzwerkmanagementdienstleistungen und sowie (im separaten Antragsverfahren) Entwicklungsprojekte des Netzwerks. Eine Einschränkung auf bestimmte Technologiefelder und Branchen besteht nicht.
Die Förderung der Netzwerkeinrichtung ist degressiv; dei Fehlbeträge sind durch die Netzwerkmitglieder zu finanzieren.
Im Rahmen des Arbeitsprogramms 2024 des Europäischen Innovationsrates gibt es eine Finanzierungsmöglichkeit für „Enabling virtual worlds and augmented interaction in high-impact applications to support the realisation of Industry 5.0“ (EIC Accelerator). Das spezifische Ziel der Herausforderung besteht darin, die Entwicklung und den Einsatz fortschrittlicher Technologielösungen für virtuelle Welten für die Industrie zu unterstützen, die auf den Menschen ausgerichtet, nachhaltig und widerstandsfähig in ihrem Design und/oder Benutzerkontext sind.
Gefördert werden digitale Geschäftsideen, die auf Mobilitäts-, Geo- und Wetterdaten basieren, angefangen vom Konzept über die Entwicklung bis hin zur Marktreife. Bewerben können sich Gründer, Startups, Unternehmen, staatliche und nichtstaatliche Hochschulen, Vereine, sowie Behörden und Einrichtungen mit Forschungs- und Entwicklungsaufgaben. Die Projekte werden bis zu drei Jahre mit maximal drei Millionen Euro gefördert.
E-Mail: info @ mfund.de
Hotline:
+49 221 806 4227 (TÜV Rheinland Consulting GmbH)
+49 30 31 0078 5495 (VDI/VDE Innovation + Technik GmbH)
Die Förderrichtlinie „Digitalisierung der Fahrzeughersteller und Zulieferindustrie“ dient der Förderung der umfassen-den Erforschung und Entwicklung (FuE) innovativer, datenorientierter Produktionsverfahren und der Implementierung von Industrie 4.0 in den Wertschöpfungssystemen der Fahrzeughersteller und Zulieferindustrie. Sie unterstützt das in der Nationalen Industriestrategie 2030 formulierte Ziel zur Stärkung neuer Technologien als entscheidenden Treiber des Strukturwandels. Auch die in der Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung verankerte Zielsetzung zur Stär-kung des Ideen-, Wissens- und Technologietransfers wird direkt angesprochen. Sie ist zudem in den vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) im Juni 2020 gestarteten „Transformationsdialog Automobilwirtschaft“ und in der vom BMWi und Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) getragenen „Plattform Industrie 4.0“ eingebunden.

Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeitende und Unternehmer:innen zum Thema Technologie und Wissenstransfer.
Das Seminar bietet Ihnen kreative Impulse um die Innovationsentwicklung stärker auf den Kunden auszurichten. Mit Design Thinking und Business Model Generation lernen Sie hands-on eine der wichtigsten Methoden und Tools für eine strukturierte, kundenzentrierte Innovations- und Produktentwicklung kennen. Die Weiterbildung beinhaltet vier Präsenztage an der Hochschule der Medien in Stuttgart und eine ca 3-monatige Online-Phase als Selbststudium.
Bei erfolgreichem Abschluss inklusive Prüfung erhalten die Teilnehmenden ein Hochschulzertifikat (ECTS), das auch auf ein Masterstudium angerechnet werden kann.
Die Teilnahmegebühr beträgt 1200 EUR zzgl 100 EUR Prüfungsgebühr
Das Angebot dient vor allem Unternehmen aus der fertigenden Industrie, die ihre Entwicklungsprozesse digitalisieren möchten. Das betrifft beispielsweise die digitale Produktentwicklung und die digitale Fertigungsplanung. Bei der Herstellung komplexer Produkte kommt der Vorab-Simulation und Visualisierung eine immer größere Bedeutung zu – denn diese helfen entscheidend, Fehler zu vermeiden und Entwicklungsprozesse wettbewerbsfähig zu halten. In Baden-Württemberg betrifft dies viele Unternehmen, die im Maschinen- und Anlagenbau, in der Automobilbranche sowie in der Luft- und Raumfahrt tätig sind.
Vom Megatrend der Digitalisierung sind Unternehmen aller Größen und Wirtschaftszweige gleichermaßen betroffen. Im Gegensatz zu Konzernen und großen Familienunternehmen besteht bei kleinen und mittelständischen Unternehmen jedoch nach wie vor Aufholbedarf bei der Digitalisierung. Diese wettbewerbsentscheidende Entwicklung von KMU wird bisher teilweise noch unzureichend vollzogen. Die Initiative „Digitallotsen“ leistet einen Beitrag dazu, insbesondere KMU bei ihren Digitalisierungsprozessen zu begleiten und zu unterstützen.
In den Sprechstunden können sich interessierte Vertreter von KMU über neue Geschäftsmöglichkeiten und Prozesse der virtuellen Produktentwicklung und Fertigungsplanung erkundigen. Es werden Kontakte zu Ansprechpartnern im Bereich der digitalisierten Entwicklungsprozesse vermittelt und aktuelle Trends im Virtuellen Engineering sowie in Virtual Reality und Augmented Reality aufgezeigt. Die Sprechstunden finden quartalsweise in den folgenden Städten statt: Aalen, Albstadt, Freiburg, Friedrichshafen, Heilbronn, Karlsruhe, Mannheim, Pforzheim, Reutlingen, Schwäbisch Hall, Stuttgart, Sankt Georgen, Tuttlingen und Ulm. Außerdem ist eine individuelle Terminabstimmung möglich.
Das Projekt „Lotsen für die Digitalisierung von Planungs- und Entwicklungsprozessen“ des VDC wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg gefördert. Ziel des Projektes ist es, mittelständische Unternehmen mit geeigneten Maßnahmen bei der Digitalisierung zu unterstützen. Das VDC erarbeitet als Digitallotse weitere Maßnahmen zur konkreten Unterstützung von KMU, beispielsweise einen Virtual-Engineering-Anwendungsatlas und ein digitales Transfer- und Informationssystem. Daneben werden regionale Veranstaltungen zu Digitalisierungsthemen organisiert.
Mit den flexiblen, berufsbegleitenden Kontaktstudiengängen können Sie sich oder Ihre Mitarbeiter auf dem Fachgebiet Data Science and Business Analytics weiterbilden. Sie können aus verschiedenen Paketen wählen, die aus je drei Modulen bestehen, um sich so passgenau in Ihrem Themengebiet zu qualifizieren.
Folgende Pakete stehen zur Auswahl:
Die Teilnahmegebühr für das Paket beträgt 4200 EUR zzgl 300 EUR Prüfungsgebühr
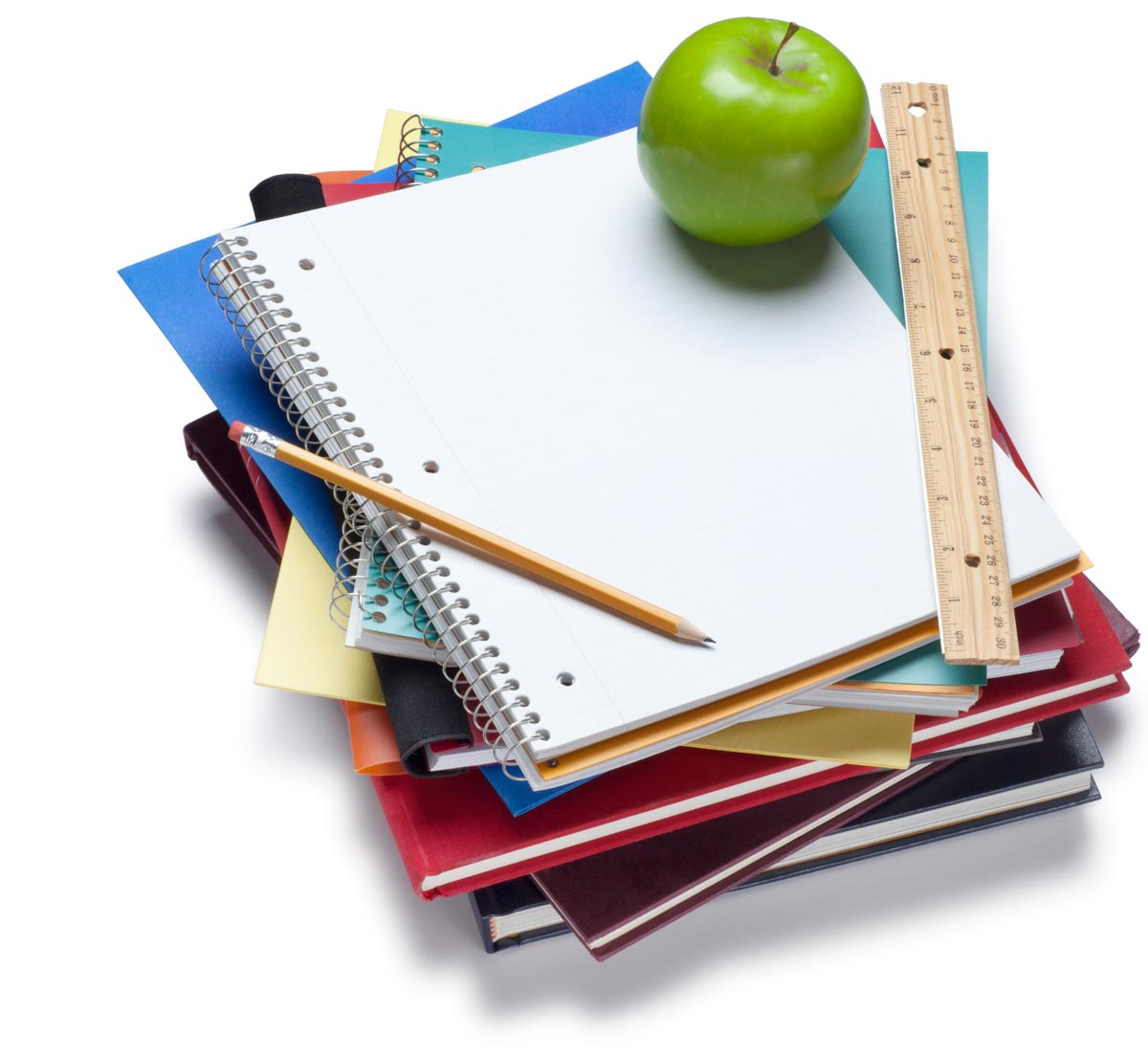
Publikationen und Studien zu Digitalisierungsthemen im Bereich Technologietrends und Wissenstransfer.
Künstliche Intelligenz hat die Forschungslabore verlassen und durchdringt atemberaubend schnell Alltag und Arbeitswelt in Form sprechender Geräte und digitaler Assistenten, kooperativer Roboter, autonomer Fahrzeuge und Drohnen. Das Smart Data Forum machte Ergebnisse aus der deutschen und internationalen Spitzenforschung für den Mittelstand leicht zugänglich und hilft bei der erfolgreichen Umsetzung innovativer Digitalisierungskonzepte und Technologien in der unternehmerischen Praxis.
Beispiele aus neun Einsatzbereiche werden vorgestellt und abhängig von der Aufgabe und den verarbeiteten Daten weiter untergliedert. Der Beispielsammlung vorangestellt sind ein kurzer Abriss zur Geschichte der Künstlichen Intelligenz, die wichtigsten Konzepte des Maschinellen Lernens als aktuelle Schlüsseltechnologie für intelligente Lösungen und ein Ausblick auf Trends in der Forschung.
Die präsentierten Ergebnisse basieren außerdem auf weiteren, bei Fraunhofer im Jahr 2017 beauftragten Analysen des Marktes, des Forschungsgebietes und der Ausbildungssituation.
Der "Monitoring-Report - Wirtschaft DIGITAL Baden-Württemberg" wurde im Auftrag des Wirtschaftsministeriums vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und Kantar TNS exklusiv erstellt. Im Rahmen der Erstellung der Studie wurde im Herbst 2017 die Führungsebene von 1.145 Unternehmen in Baden-Württemberg nach ihrer aktuellen Einschätzung und ihrer Prognose für das Jahr 2022 bezüglich des Fortschritts bei der Digitalisierung befragt. Die Ergebnisse - hier speziell für die Bauwirtschaft - bilden demnach hinsichtlich Gegenwart und Zukunft die Einschätzungen der Befragten ab.
Get Connected: mit der neu erschienenen digitalen Broschüre zeigt das Land Baden-Württemberg Wege auf, wie sich kleine und mittlere Unternehmen fit für das digitale Zeitalter machen und wo sie sich zu Digitalisierungsthemen informieren können. Für interessierte Unternehmen werden Beispiele, Beteiligungsangebote und Programme für die Zukunftsthemen Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Internet der Dinge in Baden-Württemberg und Europa aufbereitet.
Neben den Angeboten in Baden-Württemberg bietet auch die EU baden-württembergischen Unternehmen vielfältige Möglichkeiten. So unterstützt die EU-Digitalpolitik die Wirtschaft Europas mit einem Budget von 9,2 Milliarden Euro.
Die digitale Broschüre dient als Wegweiser durch die digitale (Förder-) Landschaft. Sie stellt die Leuchtturmprojekte in Baden-Württemberg und in Europa vor und veranschaulicht, wie Unternehmen von der Digitalisierung profitieren können.
Der Siegeszug der Robotik in Produktionsumgebungen ist nicht mehr aufzuhalten. Nicht zuletzt die rasante Entwicklung der Robotik hat einen großen Anteil an der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Glaubt man den Experten, steht uns nun nach einem halben Jahrhundert der dominanten Industrierobotik ein halbes Jahrhundert der Servicerobotik bevor. Die Zahlen belegen diesen Trend.
Im Vordergrund stehen hier die Zahlen für Servicerobotikprodukte im Bereich Militär, Sicherheit, Überwachung,Reinigung und mobile Plattformen. Hieraus kann zumindest für Serviceroboter zur Überwachung und Intervention sowie autonom agierende Serviceroboter ein spürbares Marktwachstum in den nächsten zehn Jahren abgeleitet werden.
Aber nicht nur die Zahlen belegen das wirtschaftliche Potenzial der Servicerobotik. In einer durch den demographischen Wandel beständig älter werdenden Gesellschaft gewinnt die Rolle assistierender Serviceroboter sowohl im privaten als auch betrieblichen Kontext zunehmend an Bedeutung. Im Jahr 2035 wird in Deutschland mehr als die Hälfte der Bevölkerung 50 Jahre oder älter und jeder Dritte älter als 60 Jahre sein. Qualifizierte Mitarbeiter werden ein knappes Gut. Daher ist zu erwarten, dass der Servicerobotik eine wesentliche Rolle in der industriellen Produktion zufallen wird, um die wachsende demographische Lücke zu füllen.
Diese Publikation wurde im Rahmen der Begleitforschung zum BMWi-Förderprogramm AUTONOMIK erstellt.
In hohem Tempo verändert der digitale Wandel unser gesamtes Wirtschafts- und Arbeitsleben. Neue Technologien stellen langjährig etablierte Prozesse und mitunter ganze Geschäftsmodelle
in Frage und bieten gleichzeitig neue Zukunftschancen. Das gilt auch für das Gastgewerbe als große, wirtschaftlich bedeutende mittelständische Branche in Baden-Württemberg. Unternehmerinnen und Unternehmer in Gastronomie und Hotellerie stehen vor der Herausforderung, die Vorteile der Digitalisierung zu erkennen und für ihre Betriebe zu nutzen.