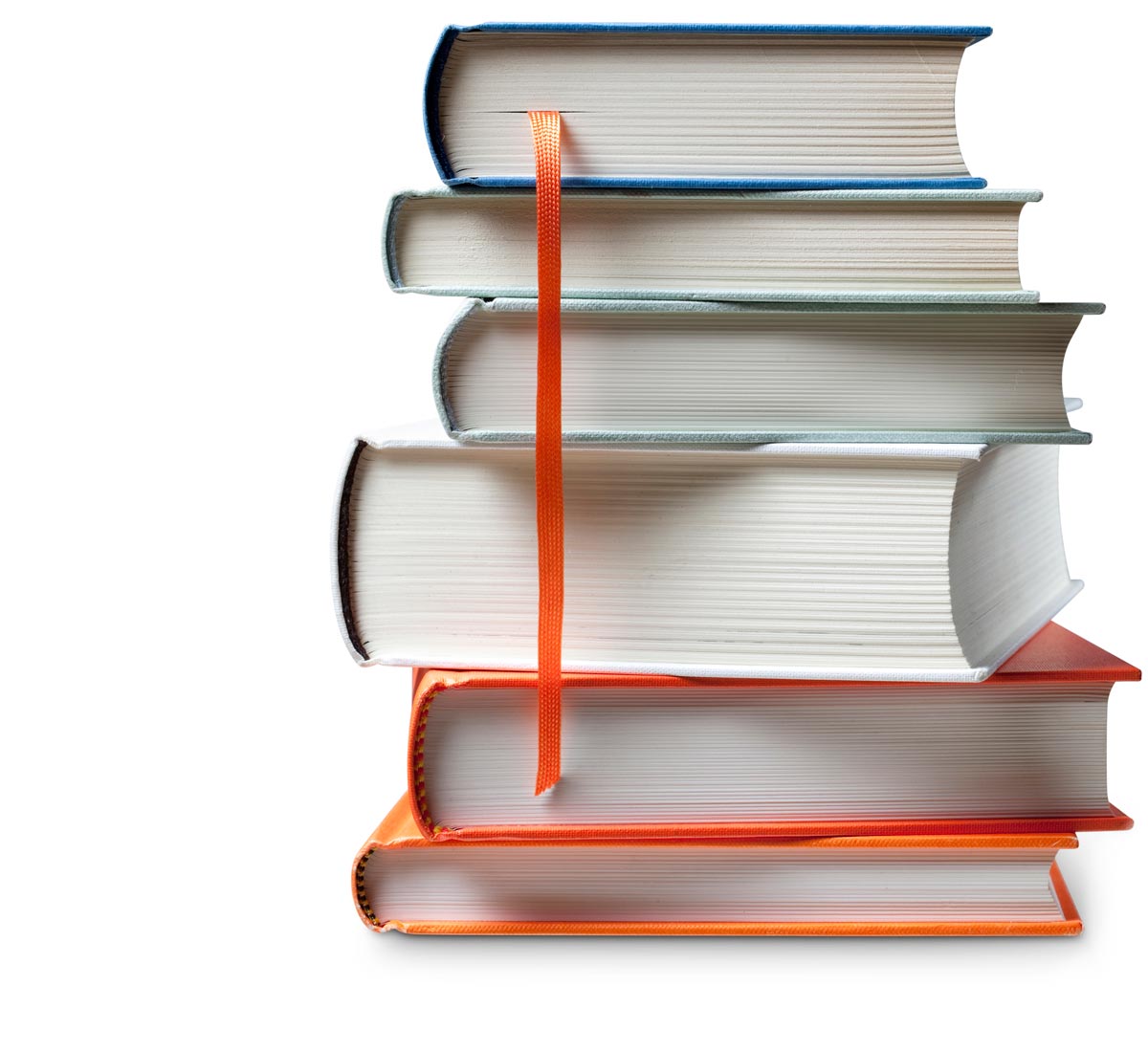Industrie 4.0: Digitalisierung in der Industrie.
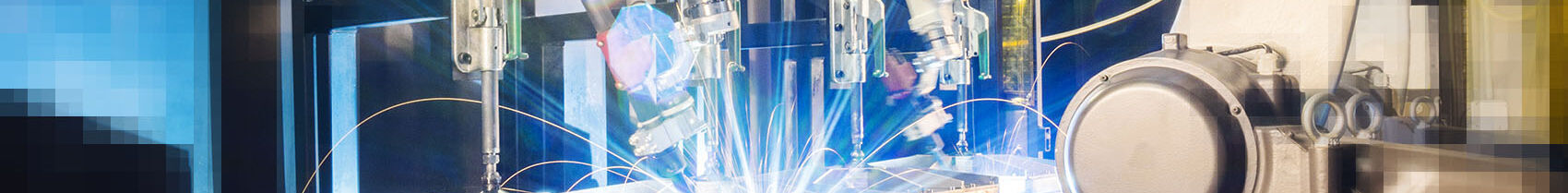
Das produzierende Gewerbe entspricht in etwa dem Industriesektor, der vor allem durch maschinelle Produktion, Arbeitsteilung und Fertigung größerer Stückzahlen gekennzeichnet ist. Bedingt durch den traditionell hohen Technologisierungsgrad und den weit verbreiteten Maschineneinsatz ist die Digitalisierung im produzierenden Gewerbe – oft unter dem Begriff der vierten industriellen Revolution oder Industrie 4.0 zusammengefasst – bereits weit verbreitet und gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Der Trend im produzierenden Gewerbe geht zu immer stärker individualisierten Produkten, die ganz auf die jeweiligen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden können. Auch Kleinserien sollen kostengünstig und effizient hergestellt werden können. Dazu muss die Produktion flexibler werden. Durch die Integration von Computerchips in Geräte sowie (teil)autonome Maschinen, die in der Lage sind, ohne menschliche Steuerung zu handeln (die so genannte Smart Factory) und den ständigen Austausch der intelligenten Technologien können auch kurzfristige Änderungen vorgenommen werden.
Ebenso findet eine immer stärkere Verschmelzung von Produkten und Dienstleistungen, wie beispielsweise Wartungsdienstleistungen für Maschinen, statt. Weitere Neuerungen im produzierende Gewerbe sind auch technologische Entwicklungen wie 3D-Drucker, die immer häufiger zum Einsatz kommen.
Mithilfe der Digitalisierung sind Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe nicht nur in der Lage, eine Echtzeitsteuerung der Produktion zu erreichen, sondern auch Energie- und Ressourcen effizienter einzusetzen und die eigene Produktivität zu steigern.

Informationen und Beratung zu Digitalisierungsthemen für Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe.
Um den Beratungsbedarf bei KMU zum Thema Industrie 4.0 ermitteln zu können, hat die ClusterAgentur BW mit dem VDC Fellbach ein Erstberatungstool entwickelt. Dazu wird ein standardisiertes Interview geführt. Mit der Analyse der Ergebnisse können die Clustermanager den befragten Unternehmen passgenaue Hinweise zu Experten, Fördermöglichkeiten und anderen Unterstützungsangeboten geben. So sollen KMU die Möglichkeit eröffnet werden, sich zielgerichtet und eingehender mit dem Thema zu befassen.
Mit dem Website-Check-Tool können IHK-Mitgliedsunternehmen aus der Region Bodensee-Oberschwaben ihre Website von neutraler Stelle aus prüfen lassen. Dazu prüft die IHK die Website mit einer Software auf rund 40 häufige Fehler bzw. Optimierungsmöglichkeiten, etwa die verbesserte Darstellung für Mobilgeräte oder Fehler im Impressum. Die Untersuchung umfasst technische, inhaltliche und rechtliche Aspekte. Abschließend erhalten die Unternehmen einen individuellen Report mit den Ergebnissen sowie weiterführenden Erläuterungen.
Die IHK Heilbronn-Franken bietet ein umfassendes Beratungsangebot zum Thema Industrie 4.0 für KMU. Ziel ist es, den Unternehmen den Nutzen von Industrie 4.0 Lösungen für die eigene Produktion zu vermitteln und aufzuzeigen, wie neue Geschäftsmodelle erarbeitet oder Kooperationen mit Hochschulen geknüpft werden können. Das Angebot der IHK umfasst unter anderem einen Online-Leitfaden mit Selbstcheck, Best-Practice-Workshops sowie Start-up Veranstaltungen.
Mit der Gründungswerkstatt Heilbronn-Franken hilft die IHK Existenzgründern und Jungunternehmern bei der Planung und Umsetzung ihrer Geschäftsidee. So kann etwa mithilfe eines Tutors ein Online-Businessplan angelegt werden. Darüber hinaus bietet die Seite wichtige Informationen für Gründer, einen Persönlichkeits- und Wissenstest, sowie Praxis-Hilfen für den Unternehmensalltag.
Im Rahmen eines einstündigen Gesprächs werden erste mögliche Handlungsfelder im Themengebiet Industrie 4.0 identifiziert. Das VDC hat zu diesem Zweck gemeinsam mit der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH einen Gesprächsleitfaden entwickelt, anhand dessen die wichtigsten Fragestellung schnell und strukturiert abgearbeitet werden können. Das Unternehmen enthält die Dokumentation des Gesprächs, die auch die Ableitung möglicher erster Maßnahmen enthält.

Fördermöglichkeiten für innovative Digitalisierungsvorhaben im produzierenden Gewerbe.
Unterstützt werden Unternehmensgründungen, bei denen Produkte oder Dienstleistungen aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik. Die besten Gründungsideen haben die Aussicht auf Preise in Höhe von bis zu 32.000 Euro.
Gefördert werden Forschungs-und Entwicklungsaktivitäten sowie diese unterstützende Leistungen zur Markteinführung für innovative Produkte, Verfahren oder technische Dienstleistungen ohne Einschränkung auf bestimmte Technologien und Branchen.
Die Förderquote für Einzelprojekte ist abhängig von Größe und Alter des Unternehmens und beträgt bei Firmensitz in Baden-Württemberg 25 % (Unternehmen > 250 Beschäftigte), 35 % (Unternehmen 50 bis 250 Beschäftigte), 40 % (Unternehmen < 50 Beschäfttige) bzw. 45% (Unternehmen < 50 Beschäfttige, jünger als 10 Jahre). Weitere Vorgaben bezüglich verbundener Unternehmen, Umsatz und Bilanzsumme sind in der Richtlinie erläutert.
Die Zielgruppe dieses Förderprogramms sind Start-ups und KMU, die disruptive, hochrisikoreiche Innovationen mit großem Marktpotential umsetzen wollen. Dabei muss für die Beantragung der Förderung mindestens ein Demonstrator vorliegen (Technologiereifegrad 5 oder 6). Im Gegensatz zum EIC Pathfinder ist nur eine Einzelantragsstellung möglich.
Projektskizzen können jederzeit eingereicht werden, entweder themenoffen (Accelerator Open) oder auf bestimmte Herausforderungen fokussiert (Accelerator Challenges). Bei positiver Bewertung der Skizze kann ein Vollantrag eingereicht werden. Die Auswertung der Vollanträge erfolgt an Stichtagen. Start-ups und KMU aus Baden-Württemberg erhalten Informationen und Unterstützung für Anträge. Weitere Hinweise finden der Webseite www.innocheck-bw.de des Unterstützungsprojekts für Start-ups und KMU beim Steinbeis Europa Zentrum, gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte ebenfalls der Webseite des Unterstützungsprojekts.
Angesprochen werden Unternehmen aus Gewerbe und Handwerk, die mit Hilfe externer Beratung ein innovatives Produkt oder ein innovatives technisches Verfahren in ihrem Unternehmen einführen wollen. Über „go-Inno“ können diese Unternehmen 50 Prozent ihrer Ausgaben für die Beratungsleistung bei einem der dafür autorisierten Beratungsunternehmen decken. Die Gutscheine sind beim Beratungsunternehmen erhältlich, ein Antragsverfahren ist nicht erforderlich.
Das Land Baden-Württemberg fördert Lernfabriken sowie die Einführung und Nutzung von Tablets in Berufsschulen für die Bereiche der Mechatronik, der Kraftfahrzeugmechatronik sowie das Büromanagement. Um belastbare und erprobte Ergebnisse zur digitalen Anwendung in der beruflichen Ausbildung zu gewinnen, sollen Modellprojekte entwickelt und exemplarisch umgesetzt werden. Ziele sind u.a. die Qualität und die Attraktivität der Berufsausbildung zu steigern. Die Förderung der ausgewählten Projekte beträgt je Vorhaben 200.000 Euro. Gefördert werden u.a. Hochschulen sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Kooperationsverbünde sind möglich, auch in Kooperation mit Unternehmen.

Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter und Unternehmer zum Thema Digitalisierung in der Produktion.
Eingerichtet an beruflichen Schulen dienen sie in erster Linie der Vorbereitung von Fach- und Nachwuchskräften auf die Anforderungen der Industrie 4.0, indem sie Auszubildende und Teilnehmer an Weiterbildungskursen an die Bedienung von Anlagen auf Basis realer Industriestandards heranführen. Die Lernfabriken helfen dabei, das abstrakte Konzept von Industrie 4.0 für Nachwuchskräfte und Beschäftigte greifbar zu machen.
Die DIGITRANS-Methode leitet KMU mithilfe auf sie angepasster Innovationsmethoden durch die Entwicklung und Einführung eines digitalen Geschäftsmodells. Sie unterteilt sich in die Innovations- und Transformationsphase. In der Innovationsphase entwickeln die KMU eine neue digitale Geschäftsidee; die Transformationsphase beschäftigt sich mit der nachhaltigen Einführung und Umsetzung des neuen digitalen Geschäftsmodells in der Gesamtorganisation des Unternehmens. Das von der EU geförderte Projekt DIGITRANS ist eine Kooperation von 15 Projektpartnern aus sieben Ländern in der Donauregion. KMU, Wirtschaftsförderungseinrichtungen sowie Trainer und Berater, die Schulungen zur digitalen Transformation durchführen, finden praxisbezogene Schulungsmaterialien und Hilfestellungen auf dieser Plattform.
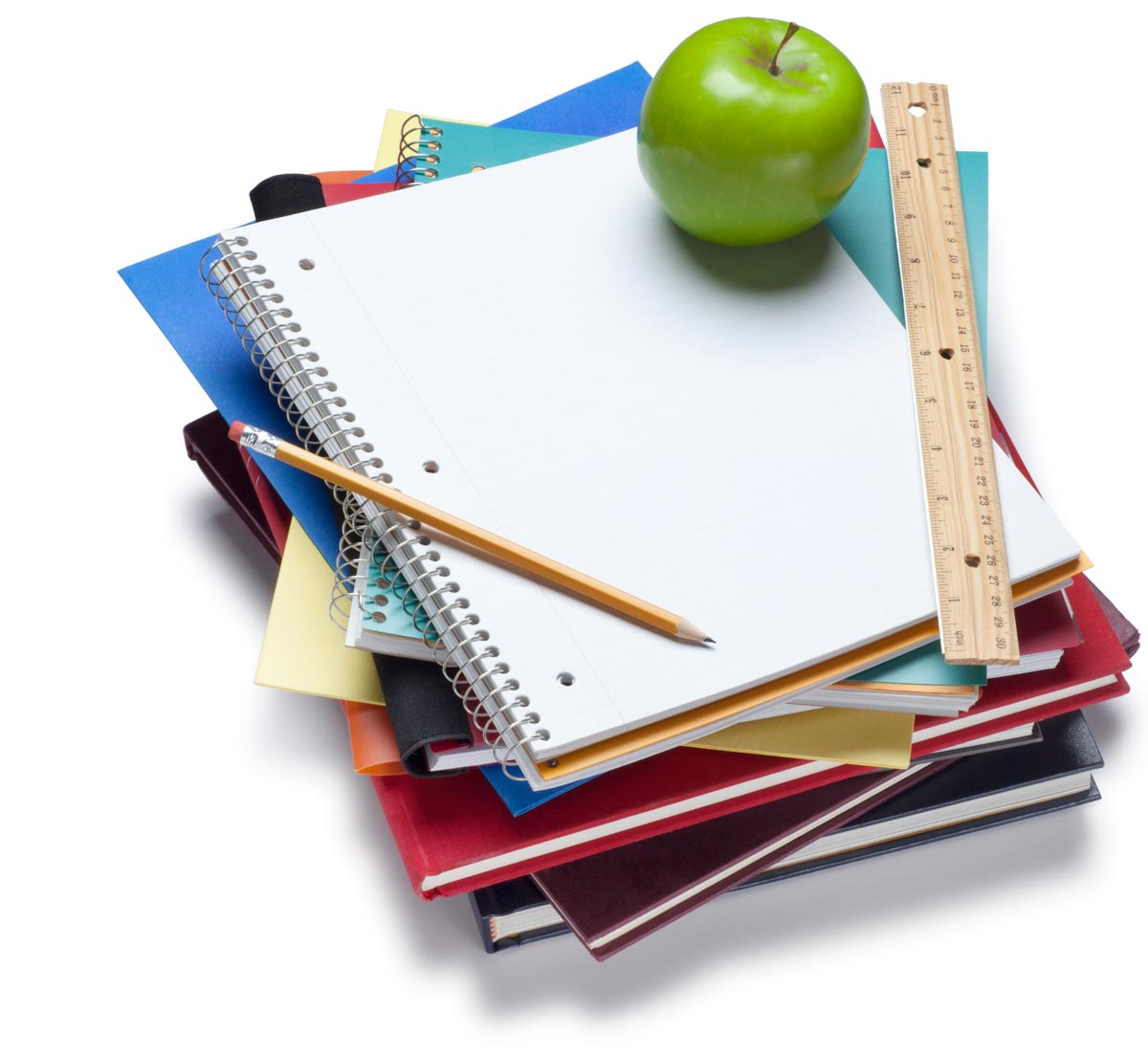
Publikationen und Studien zu Digitalisierungsthemen für Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe.
Im Zeitraum von April 2018 bis April 2019 untersuchten Communication Consultants und VICO Research & Consulting das Kommunikationsverhalten von 350 Mittelständlern aus dem produzierenden Gewerbe der DACH-Region. Wie schon in der Vorjahresstudie zeigte sich, dass Digitalisierung das Netz stark beschäftigt. Während Journalisten, Blogger und User viel über den digitalen Wandel sprechen, greift die Mehrheit der Mittelständler das Thema jedoch nicht aktiv auf. Dabei hätten die Unternehmen eigentlich gute Chancen, in der sehr regen Diskussion rund um den digitalen Wandel ganz vorne mitzumischen und sich als Experten zu positionieren.
Ziel dieser Studie war es, die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für den Standort Baden-Württemberg überblicksartig herauszuarbeiten. Dabei werden folgende fünf Bereiche der Digitalisierung betrachtet: Wirtschaft, Mobilität, Bildung und Weiterbildung, Gesundheitswesen, E-Government / digitale Kommune.
Als Querschnittsthemen werden Forschung, Entwicklung und Innovation, Digitale Infrastruktur, Nachhaltigkeit und Cybersicherheit betrachtet.
Zu jedem Bereich werden die Ausgangssituation allgemein auf Basis von bestehenden Studien dargestellt,
Der Digitalisierungsgrad der Wirtschaft variiert nach Branchen und Größenklassen. Dabei liegen die IKT-Branche und die wissensintensiven Dienstleistungen ganz vorne, während das Gesundheitswesen noch sehr niedrig digitalisiert ist.
Technische Regelsetzung bedeutet im Allgemeinen die Erstellung und Herausgabe von Dokumenten wie Normen, Spezifikationen, Leitfäden, Richtlinien oder technischen Berichten unter Einhaltung der dafür vorgesehenen Erarbeitungsprozesse.
Das Einsatzgebiet technischer Regeln ist vielfältig. Sie sind beispielsweise dann erforderlich, wenn gleichartige oder ähnliche Gegenstände, Methoden und Verfahren in unterschiedlichen Anwendungsfällen an verschiedenen Orten von verschiedenen Nutzergruppen zum Einsatz kommen. Sie dienen damit im weitesten Sinne der Vereinheitlichung. Werden die in den technischen Regeln festgelegten Anforderungen eingehalten, was durch unabhängige Prüfinstitute bescheinigt werden kann, lassen sich Produkte, Prozesse und Dienstleistungen untereinander vergleichen, und es ist u. a. ein Mindestniveau an Sicherheit, Austauschbarkeit und Interoperabilität sichergestellt.
Eine technische Norm (kurz: Norm) wird von einer anerkannten Normungsorganisation nach festgelegten WTO-konformen Grundsätzen konsensbasiert erarbeitet. Technische Spezifikationen (kurz: Spezifikation) dagegen werden häufig nach vereinfachten Verfahren erstellt, die eine schnellere Anwendung ermöglichen und deren Festlegungen nicht im Konsens des gesamten Gremiums festgelegt werden müssen. Dabei sollte stets das Ziel sein, die technischen Spezifikationen zu einer Norm weiterzuentwickeln. Die Begriffe Normung bzw. Standardisierung bezeichnen den definierten Prozess, an dessen Ende als Ergebnis eine Norm oder eine Spezifikation zur Verfügung steht.
Der "Monitoring-Report - Wirtschaft DIGITAL Baden-Württemberg" wurde im Auftrag des Wirtschaftsministeriums vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und Kantar TNS exklusiv erstellt. Im Rahmen der Erstellung der Studie wurde im Herbst 2017 die Führungsebene von 1.145 Unternehmen in Baden-Württemberg nach ihrer aktuellen Einschätzung und ihrer Prognose für das Jahr 2022 bezüglich des Fortschritts bei der Digitalisierung befragt. Die Ergebnisse - hier speziell für die Bauwirtschaft - bilden demnach hinsichtlich Gegenwart und Zukunft die Einschätzungen der Befragten ab.
Die Gründe hierfür werden in der Studie „Die Psychologie der Digitalisierung - Wie sich Digitalisierung für den Mittelstand anfühlt“ untersucht. Dabei zeigt sich: Die Digitalisierung des Unternehmens wird als eine lästige Pflichtübung aufgefasst, da sie vor allem mit Verantwortung, Korrektheit, aber auch mit Leistung und Status verbunden wird. Befragt wurden dafür 500 Entscheider aus mittelständischen Unternehmen.