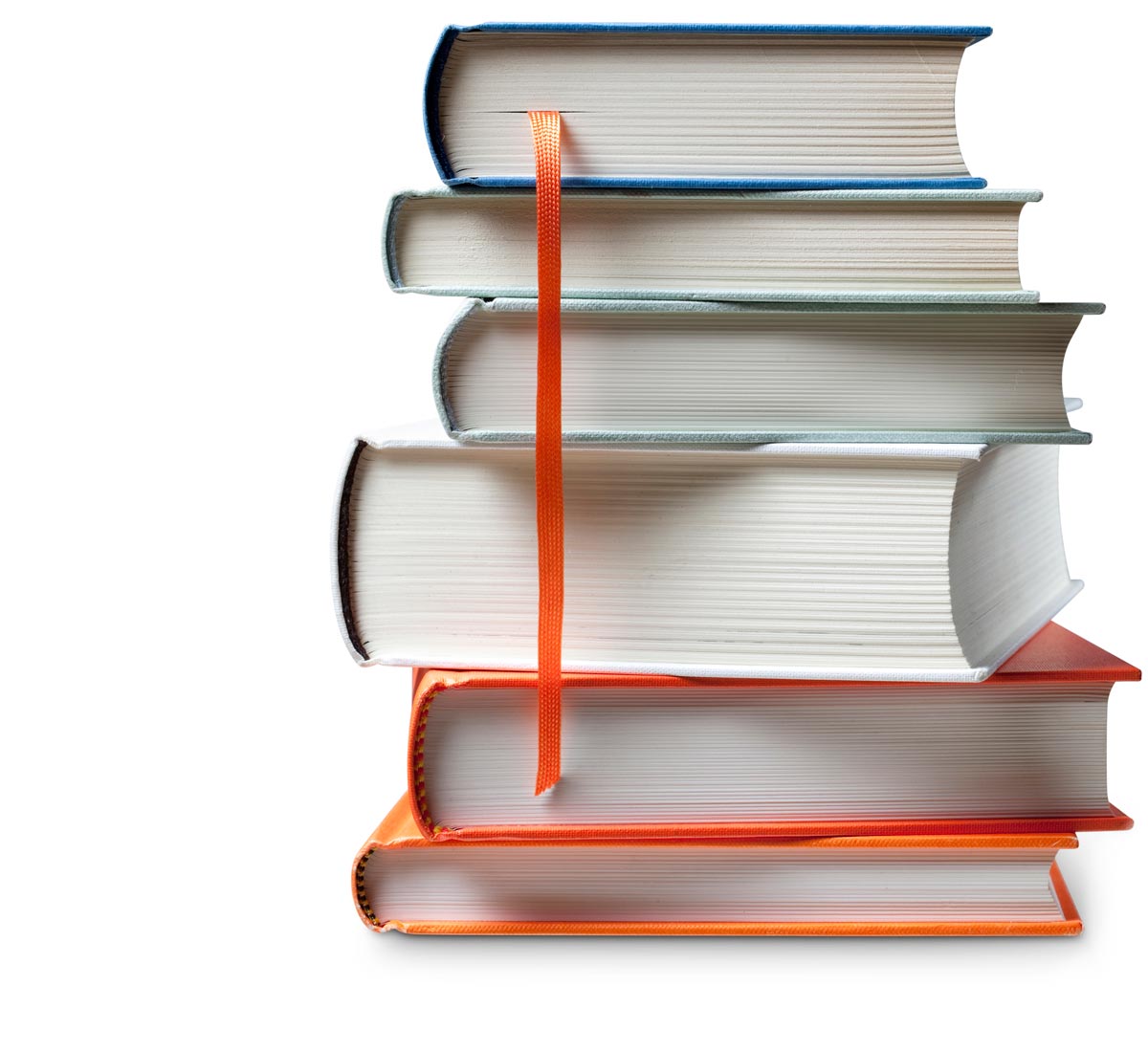Industrie 4.0: Digitalisierung in der Industrie.
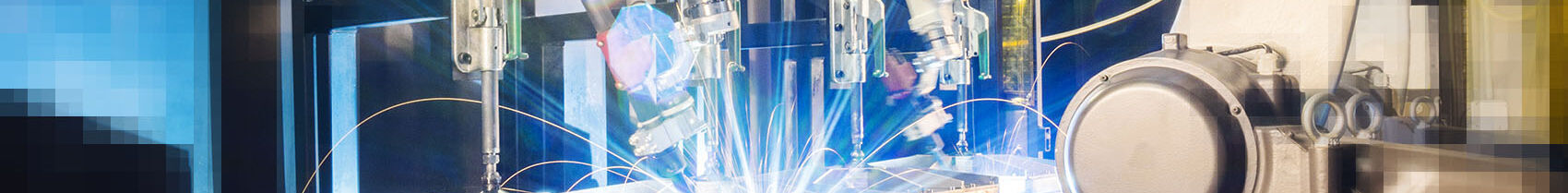
Das produzierende Gewerbe entspricht in etwa dem Industriesektor, der vor allem durch maschinelle Produktion, Arbeitsteilung und Fertigung größerer Stückzahlen gekennzeichnet ist. Bedingt durch den traditionell hohen Technologisierungsgrad und den weit verbreiteten Maschineneinsatz ist die Digitalisierung im produzierenden Gewerbe – oft unter dem Begriff der vierten industriellen Revolution oder Industrie 4.0 zusammengefasst – bereits weit verbreitet und gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Der Trend im produzierenden Gewerbe geht zu immer stärker individualisierten Produkten, die ganz auf die jeweiligen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden können. Auch Kleinserien sollen kostengünstig und effizient hergestellt werden können. Dazu muss die Produktion flexibler werden. Durch die Integration von Computerchips in Geräte sowie (teil)autonome Maschinen, die in der Lage sind, ohne menschliche Steuerung zu handeln (die so genannte Smart Factory) und den ständigen Austausch der intelligenten Technologien können auch kurzfristige Änderungen vorgenommen werden.
Ebenso findet eine immer stärkere Verschmelzung von Produkten und Dienstleistungen, wie beispielsweise Wartungsdienstleistungen für Maschinen, statt. Weitere Neuerungen im produzierende Gewerbe sind auch technologische Entwicklungen wie 3D-Drucker, die immer häufiger zum Einsatz kommen.
Mithilfe der Digitalisierung sind Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe nicht nur in der Lage, eine Echtzeitsteuerung der Produktion zu erreichen, sondern auch Energie- und Ressourcen effizienter einzusetzen und die eigene Produktivität zu steigern.

Informationen und Beratung zu Digitalisierungsthemen für Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe.
Mit der Gründungswerkstatt Heilbronn-Franken hilft die IHK Existenzgründern und Jungunternehmern bei der Planung und Umsetzung ihrer Geschäftsidee. So kann etwa mithilfe eines Tutors ein Online-Businessplan angelegt werden. Darüber hinaus bietet die Seite wichtige Informationen für Gründer, einen Persönlichkeits- und Wissenstest, sowie Praxis-Hilfen für den Unternehmensalltag.
Die Digital-Experten analysieren, optimieren und unterstützen die Unternehmensprozesse, Technologien, Produkte und Geschäftsmodelle ganz nach den Bedarfen der lösungssuchenden KMU. Die DIZ Digitalsierungs-Experten zeichnen sich durch Ihre Kompetenz, Ihre Branchenerfahrung und Ihre Expertise aus. Das DIZ steht hierbei als neutrales Kompetenzzentrum an Ihrer Seite und unterstützt bei der Auswahl eines passenden Experten.
Mit dem kostenlosen IHK-Demografierechner (DemoR) können Unternehmen ihre betriebliche Altersstruktur und deren Veränderung bis zum Jahr 2030 untersuchen. Innerhalb weniger Minuten kann mit dem Online-Rechner die demografische Situation des Unternehmens ermittelt und innerhalb einer beliebigen Branche und Region verglichen werden. Mit den Ergebnissen aus der Webanwendung wird ersichtlich, ob und zu welchem Zeitpunkt Ersatzbedarf für Mitarbeiter bestehen wird. Die Daten aus dem DemoR ermöglichen somit eine verbesserte Personalstrategie, da rechtzeitig nach geeigneten Alternativen gesucht oder etwa stärker in die Ausbildung sowie attraktive Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter investiert werden kann. Damit lässt sich einem möglichen Fachkräftemangel entgegenwirken. Alle Ergebnisse des Demografierechners lassen sich als PDF-Dokument abspeichern, die eingegebenen Daten werden anschließend automatisch aus dem System gelöscht.
Der Innovationsberater des Geschäftsbereichs Innovation & Umwelt berät mittelständische Betriebe zum Thema IT-Sicherheit und bietet zudem eine Rechtsberatung zum Thema Datenschutz.

Fördermöglichkeiten für innovative Digitalisierungsvorhaben im produzierenden Gewerbe.
Neben dem IT-Sicherheitscheck, der einen Überblick über den eigenen Stand der Informationssicherheit verschafft, oder dem Webseiten-Check, der den eigenen Webauftritt auf Malware überprüft, werden Handlungsempfehlungen in Form von Leitfäden und Studien sowie Informationen zu herstellerneutralen Beratungsstellen und Veranstaltungen angeboten.
Gefördert werden Forschungs-und Entwicklungsaktivitäten sowie diese unterstützende Leistungen zur Markteinführung für innovative Produkte, Verfahren oder technische Dienstleistungen ohne Einschränkung auf bestimmte Technologien und Branchen.
Die Förderquote für Einzelprojekte ist abhängig von Größe und Alter des Unternehmens und beträgt bei Firmensitz in Baden-Württemberg 25 % (Unternehmen > 250 Beschäftigte), 35 % (Unternehmen 50 bis 250 Beschäftigte), 40 % (Unternehmen < 50 Beschäfttige) bzw. 45% (Unternehmen < 50 Beschäfttige, jünger als 10 Jahre). Weitere Vorgaben bezüglich verbundener Unternehmen, Umsatz und Bilanzsumme sind in der Richtlinie erläutert.
Zum Neustart bietet die L-Bank das Programm mit drei Förderschwerpunkten an:
Hier werden Unternehmen branchenunabhängig bei der Anpassung an neue Wertschöpfungsketten unterstützt. Kleine und mittlere Unternehmen erhalten einen Tilgungszuschuss.
Das Förderprogramm WIPANO mit dem Schwerpunkt „Normung und Standardisierung“ unterstützt u.a. Unternehmen bei dem Transfer von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft. Gefördert werden KMU und Selbständige im Hauterwerb und mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen muss mind. einen Kooperationspartner, der eine öffentliche grundfinanzierte Forschungseinrichtung ist, nachweisen. Zudem müssen mind. 25 Prozent der zuwendungsfähigen Personenmonate aller Partner auf das Unternehmen entfallen. Mit max. 50 Prozent der förderfähigen Kosten werden Forschungs- und Entwicklungsprojekte bei der Marktdurchdringung innovativer Produkte, Technologien oder Dienstleistungen gefördert.
Bewerben können sich Unternehmen mit Einzelvorhaben aus den Bereichen Industrie 4.0 und Internet der Dinge. Die Projekte werden über ein Jahr mit maximal 100.000 Euro gefördert.
Dr. Sabine Hemmerling
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Projektträger Softwaresysteme und Wissenstechnologien
Rosa-Luxemburg-Str. 2
10178 Berlin
030 67055-736
E-Mail

Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter und Unternehmer zum Thema Digitalisierung in der Produktion.
Die DIGITRANS-Methode leitet KMU mithilfe auf sie angepasster Innovationsmethoden durch die Entwicklung und Einführung eines digitalen Geschäftsmodells. Sie unterteilt sich in die Innovations- und Transformationsphase. In der Innovationsphase entwickeln die KMU eine neue digitale Geschäftsidee; die Transformationsphase beschäftigt sich mit der nachhaltigen Einführung und Umsetzung des neuen digitalen Geschäftsmodells in der Gesamtorganisation des Unternehmens. Das von der EU geförderte Projekt DIGITRANS ist eine Kooperation von 15 Projektpartnern aus sieben Ländern in der Donauregion. KMU, Wirtschaftsförderungseinrichtungen sowie Trainer und Berater, die Schulungen zur digitalen Transformation durchführen, finden praxisbezogene Schulungsmaterialien und Hilfestellungen auf dieser Plattform.
Eingerichtet an beruflichen Schulen dienen sie in erster Linie der Vorbereitung von Fach- und Nachwuchskräften auf die Anforderungen der Industrie 4.0, indem sie Auszubildende und Teilnehmer an Weiterbildungskursen an die Bedienung von Anlagen auf Basis realer Industriestandards heranführen. Die Lernfabriken helfen dabei, das abstrakte Konzept von Industrie 4.0 für Nachwuchskräfte und Beschäftigte greifbar zu machen.
Über verschiedene Programme können beispielsweise mehrere Nutzer gleichzeitig von ihrem Arbeitsplatz an demselben Dokument arbeiten, sich in einem virtuellen Meetingraum austauschen, Lehrvideos anschauen oder Tests absolvieren. Weiterbildungsinhalte lassen sich auf diese Weise gezielt an die zeitlichen Möglichkeiten und individuellen Lernbedingungen der Lernenden anpassen.
Für die Anbieter von Bildungsthemen liegen die Vorteile in der hohen Ausfallsicherheit der Lernplattform, ihrer ständigen Weiterentwicklung sowie der hohen Datensicherheit zum Schutz sensibler Informationen. Bislang nutzen schon zahlreiche Verbände, Unternehmen und Institutionen das Angebot des Bündnisses für Lebenslanges Lernen in Zusammenarbeit mit der vimotion GmbH.
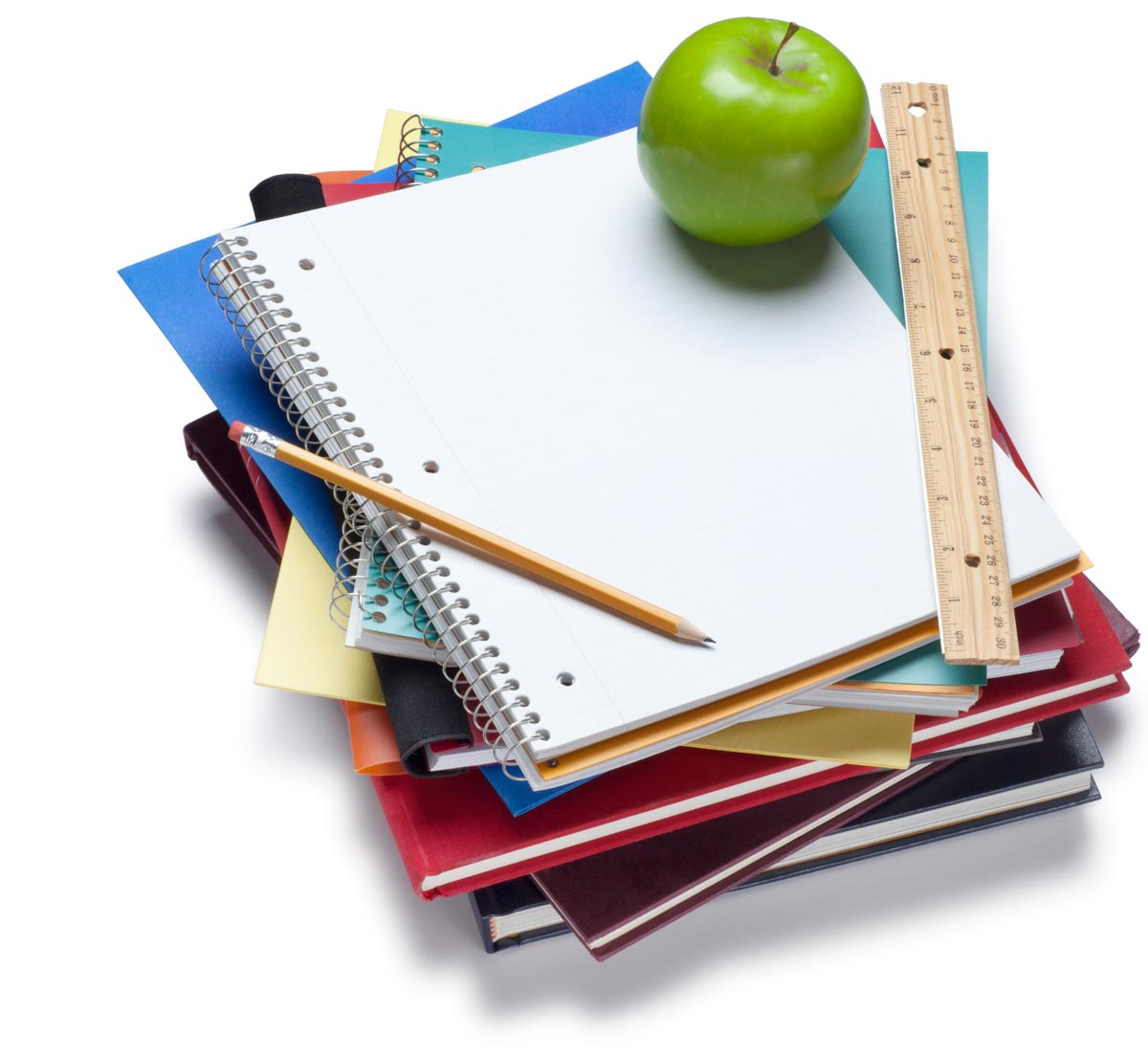
Publikationen und Studien zu Digitalisierungsthemen für Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe.
Der "Monitoring-Report - Wirtschaft DIGITAL Baden-Württemberg" wurde im Auftrag des Wirtschaftsministeriums vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und Kantar TNS exklusiv erstellt. Im Rahmen der Erstellung der Studie wurde im Herbst 2017 die Führungsebene von 1.145 Unternehmen in Baden-Württemberg nach ihrer aktuellen Einschätzung und ihrer Prognose für das Jahr 2022 bezüglich des Fortschritts bei der Digitalisierung befragt. Die Ergebnisse - hier speziell für die Chemie / Gesundheitsindustrie - bilden demnach hinsichtlich Gegenwart und Zukunft die Einschätzungen der Befragten ab.
Technische Regelsetzung bedeutet im Allgemeinen die Erstellung und Herausgabe von Dokumenten wie Normen, Spezifikationen, Leitfäden, Richtlinien oder technischen Berichten unter Einhaltung der dafür vorgesehenen Erarbeitungsprozesse.
Das Einsatzgebiet technischer Regeln ist vielfältig. Sie sind beispielsweise dann erforderlich, wenn gleichartige oder ähnliche Gegenstände, Methoden und Verfahren in unterschiedlichen Anwendungsfällen an verschiedenen Orten von verschiedenen Nutzergruppen zum Einsatz kommen. Sie dienen damit im weitesten Sinne der Vereinheitlichung. Werden die in den technischen Regeln festgelegten Anforderungen eingehalten, was durch unabhängige Prüfinstitute bescheinigt werden kann, lassen sich Produkte, Prozesse und Dienstleistungen untereinander vergleichen, und es ist u. a. ein Mindestniveau an Sicherheit, Austauschbarkeit und Interoperabilität sichergestellt.
Eine technische Norm (kurz: Norm) wird von einer anerkannten Normungsorganisation nach festgelegten WTO-konformen Grundsätzen konsensbasiert erarbeitet. Technische Spezifikationen (kurz: Spezifikation) dagegen werden häufig nach vereinfachten Verfahren erstellt, die eine schnellere Anwendung ermöglichen und deren Festlegungen nicht im Konsens des gesamten Gremiums festgelegt werden müssen. Dabei sollte stets das Ziel sein, die technischen Spezifikationen zu einer Norm weiterzuentwickeln. Die Begriffe Normung bzw. Standardisierung bezeichnen den definierten Prozess, an dessen Ende als Ergebnis eine Norm oder eine Spezifikation zur Verfügung steht.
Die achte Ausgabe mit dem Titel „Digitale Geschäftsmodelle: Erfolgsfaktoren und Praxisbeispiele“ vereint wissenschaftliche Expertenbeiträge, die eine systematische Definition digitaler Geschäftsmodelle liefern sowie Methodenwissen und Vorgehensweisen zur Digitalisierung eigener Geschäftsprozesse übermitteln, mit Praxisfälle kleiner und mittlerer Unternehmen. Diese lösungsorientierten Beispiele zeigen auf, wie Betriebe bislang mit den Herausforderungen rund im digitale Geschäftsmodelle umgegangen sind.
Bereits heute gelten HMI als Aushängeschild und Treiber für positive Nutzererlebnisse und stellen als fester Bestandteil des Maschinendesigns einen wesentlichen Wettbewerbsfaktor dar. Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen bei der konsequenten Ausrichtung ihrer Prozesse, Produkte und Geschäftsmodelle an die Bedingungen einer vernetzten digitalen Welt jedoch vor großen Herausforderungen.
Die vorliegende Studie ist Teil einer Studienreihe des Business Innovation Engineering Centers (BIEC) und unterstützt Unternehmen – insbesondere KMU – bei der Entwicklung von HMI. Dabei können Entwickler auf verschiedene digitale Werkzeuge zurückgreifen, aus welchen es das für einen konkreten Anwendungsfall Passende zu wählen gilt. Die Studie bietet Entscheidern und Entwicklern dazu zunächst einen Überblick über den aktuellen Stand von am Markt erhältlichen HMI-Lösungen. Darüber hinaus werden konkrete Entscheidungskriterien vorgestellt, praxisrelevantes Wissen zur Gestaltung von Nutzererlebnissen vermittelt und so eine systematische Orientierungshilfe beim Design- und Entwicklungsprozess gegeben.